Gefeiert wird mit gigantischer Lichtshow und Mega-Feuerwerk über der Stadt Ho-Chi-Minh. 50 Jahre Ende des Vietnamkrieges, der heute aus verschiedenen Perspektiven ganz unterschiedlich erzählt wird. Dokumentarfilme, Bücher und die Erinnerungen von Zeitzeug*innen erzählen von einem brutalen Krieg. Ein Krieg, der kurz nach der Unabhängigkeit Vietnams von der Kolonialmacht Frankreich begann - als Bürgerkrieg zwischen dem kommunistischen Norden gegen den so genannten amerikafreundlichen Süden. Damals schickten die USA Truppen, um den Kommunismus zu besiegen. Sie setzten die Brandwaffe Napalm und hochgiftige Chemikalien wie das Pflanzengift Agent Orange ein, was noch bei den folgenden Generationen zu schweren Erkrankungen führte. 1973 ging dieser Krieg zu Ende. Aber er hat Spuren hinterlassen im Land und seinen Nachkommen, die heute überall in der Welt leben - auch in der deutschen Diaspora. Wie erinnern sie die Vergangenheit? Wer hat die Deutungshoheit über die Geschichte Vietnams und die Bilder von damals? Aber vor allem: Wie geht es Vietnam heute?
Darüber sprechen die Autorin und Journalistin Khuê Phạm, Jennifer Johnston aus dem ARD-Studio Singapur, Lewe Paul, Referent der Konrad-Adenauer-Stiftung für Südostasien, und Charlotte Klonk, Professorin für Kunst und Neue Medien an der HU Berlin.
Podcast-Tipp: Deutschlandfunk Kultur Feature
Vietnam Tapes - Die Kriegsaufzeichnungen des Michael A. Baronowski
Ein junger Soldat im Vietnamkrieg macht Tonbandaufnahmen, es sind akustische Briefe an seine Familie. Sie dokumentieren eindrücklich das Leben in Schützengräben, die Freundschaft mit Kameraden und Gefechtshandlungen.
https://www.ardaudiothek.de/episode/feature-deutschlandfunk-kultur/vietnam-tapes-die-kriegsaufzeichnungen-des-michael-a-baronowski/deutschlandfunk-kultur/57648754/
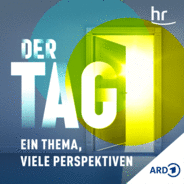
Comedy & Kabarett
Der Tag Folgen
"Ein Thema, viele Perspektiven" - von Montag bis Donnerstag immer ein Thema, das Fragen aufwirft. "Der Tag" sucht Antworten, beleuchtet Hintergründe, ordnet ein. Und spricht mit Menschen, die zum Thema etwas zu sagen haben. So entsteht ein Bild aus vielen
Folgen von Der Tag
106 Folgen
-
Folge vom 30.04.202550 Jahre nach dem Krieg: Vietnam erzählen
-
Folge vom 29.04.2025Starker Regen, trockenes Land: Das neue NormalJe wärmer die Luft, desto mehr Wasserdampf speichert sie - und dann prasselt er runter, der Regen. Dazu kommen immer öfter die sogenannten blockierenden Wetterlagen: Die Luftmassen in höheren Sphären bewegen sich nicht mehr so schnell wie vor ein paar Jahrzehnten. Und so kann aus Regen Platzregen werden, dann Starkregen und der kann zu Überschwemmungen und Sturzfluten führen. Deutschland hat das im Juli 2021 im Ahrtal erlebt. Spanien im vergangenen Jahr, in der Provinz Valencia. Gleichzeitig steigt die Zahl der Hitzetage pro Jahr und wir erleben immer öfter Wasserknappheit und Dürren. All das ist eine Folge der Klimaerwärmung. Klimaforscher sprechen von Risikojahren, mit denen wir rechnen müssen. Was geschieht gerade mit unseren Wasserkreisläufen? Wie gut sind wir darauf vorbereitet? Wie lernen wir den Umgang mit Wasserüberfluss und Wasserknappheit? Wir reden darüber mit dem Meteorologen Stefan Laps vom ARD-Wetterkompetenzzentrum, mit unserer Korrespondentin in Spanien Franka Welz, mit dem Wasserkreislauf-Experten und Ingenieur Martin Zimmermann vom Institut für sozial-ökologische Forschung in Frankfurt und mit Jörg Gerhold vom Umwelt- und Gartenamt der Stadt Kassel. Podcast-Tipp: IQ Wissenschaft & Forschung: Wo ist das Wasser? - Diese Verschiebung bringt die Erde ins Wanken In dieser Podcast-Folge wird erklärt, wie sich die weltweiten Wasservorräte Richtung Weltmeere verschieben und dabei sogar die Gewichtsverteilung innerhalb der Erde verändern. Und was wir tun können, wenn mehr und mehr Wasser sich am falschen Ort sammelt, in den Ozeanen. Denn dort ist es als Trinkwasser für Mensch und Tier verloren. https://www.ardaudiothek.de/episode/iq-wissenschaft-und-forschung/wo-ist-das-wasser-diese-verschiebung-bringt-die-erde-ins-wanken/bayern-2/14435537/
-
Folge vom 28.04.202570 Jahre in der NATO – Deutschland rüstet sichDie Erwartungen sind groß: Die transatlantische Militärallianz fordert von Deutschland eine deutlich stärkere Rolle im Bündnis. Aber was kann die in den letzten Jahrzehnten so geschrumpfte Bundeswehr leisten? In Zeiten des Kalten Krieges verfügte Deutschland über fast 500.000 Soldaten, übrig geblieben sind davon noch etwa ein Drittel. Angesichts der neuen Bedrohungen verlangt die NATO jetzt wieder eine deutlich größere Armee in Deutschland. Das ist nicht nur logistisch eine große Herausforderung, das wird auch teuer: Deutschland wird weit mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung investieren müssen. Geschenke darf Deutschland zum 70. Jahrestag seiner Mitgliedschaft im Bündnis nicht erwarten - eher große Herausforderungen. Was kommt da auf uns zu? Wir schauen auf den Festakt im NATO-Hauptquartier in Brüssel und sprechen unter anderem mit Prof. Gunther Hellmann, Politikwissenschaftler an der Goethe-Uni, Oberst André Wüstner, Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes und Dr. Sascha Hach vom Leibnitz Institut für Friedens- und Konfliktforschung. Podcast-Tipp: Was tun, Herr General? Wie kann man Putins Invasion stoppen? Welche Strategie verfolgt die russische Armee in der Ukraine? Wie stark sind die Verteidiger? Wie hilfreich ist die Unterstützung von Deutschland und NATO? MDR AKTUELL Moderator Tim Deisinger wird diese und andere drängende Fragen zum Ukraine-Krieg in diesem Podcast mit dem ehemaligen NATO-General Erhard Bühler in einer "Lagebesprechung" diskutieren. https://www.ardaudiothek.de/sendung/was-tun-herr-general-der-podcast-zum-ukraine-krieg/10349279/
-
Folge vom 24.04.2025Elbows up! Kanada zeigt KanteKanada liegt in Nordamerika, aber die Kanadier waren schon immer anders als ihre Nachbarn. Vor allem wollen sie nicht zum 51. Bundesstaat der USA werden. Seit Donald Trump diese Idee ins Spiel gebracht hat, ist ein neues Nationalbewusstsein aufgekeimt unter den Kanadiern. Dieser neue Patriotismus wirkt sich auch auf den Wahlkampf aus. Der Eishockey-Spruch “Elbows Up” ist zum Slogan der Nation geworden. Der aktuelle Premier Mark Carney hat früher auch Eishockey gespielt und sein kämpferisches Auftreten gegenüber Trump zahlt sich bisher aus in den Umfrageergebnissen seiner liberalen Partei. Sie liegt deutlich vor der lange Zeit führenden konservativen Opposition unter Pierre Poilievre. Wir wollen besser verstehen, wie Kanada tickt und was die Kanadier so anders macht. Deshalb sprechen wir mit dem Kanadisten Prof. Wolfgang Klooß, mit Stefan Rizor von der Deutsch-Kanadischen Gesellschaft, mit Alexandra Weipert, die nach Kanada ausgewandert ist und mit dem Politikwissenschaftler Prof. Oliver Schmidtke, der in Kanada lehrt. Podcast-Tipp: Bayern 2 radio wissen Nunavut heißt "unser Land" in der Sprache der Inuit; 1999 wurde das gleichnamige Territorium eingerichtet: Ein Gebiet sechsmal so groß wie Deutschland im äußersten Norden Kanadas und in direkter Nachbarschaft zu Grönland. Nur gut 40.000 Menschen leben dort in verstreuten Siedlungen und der Hauptstadt Iqaluit, knapp 31.000 von ihnen identifizieren sich als Inuit. https://www.ardaudiothek.de/episode/radiowissen/nunavut-land-der-inuit/bayern-2/13172419/
