1 bis 3 Euro Stundenlohn - so wenig verdienen Inhaftierte, die im Gefängnis arbeiten. Sieht so ein fairer Lohn für produktive Arbeit aus? Mit dieser Frage hat sich das Bundesverfassungsgericht beschäftigt und kommt zu einem eindeutigen Ergebnis: nein. Denn hier geht es nicht nur um den Wert der Arbeit, sondern auch um das Resozialisierungsgebot, welches aus dem Grundgesetz folgt. Den Gefangenen soll nämlich auch der Wert „ehrlicher“ Arbeit vor Augen geführt werden. Außerdem sollen sie die Chance erhalten, Schulden zu tilgen, Unterhalt zu zahlen und Täter-Opfer-Ausgleich zu leisten. Die Justizreporter*innen Christoph Kehlbach und Caroline Greb haben für euch hinter die Kulissen des Justizvollzugs geschaut. Sie haben mit Inhaftierten, einer JVA-Leiterin und Manuel Matzke von der Gefangenengewerkschaft gesprochen und erklären, was die Richter*innen aus Karlsruhe jetzt vom Gesetzgeber fordern.
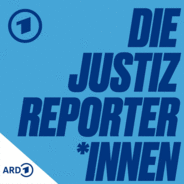
Feature
Die Justizreporter*innen Folgen
Die Justizreporter*innen, der Jura Podcast der ARD-Rechtsredaktion direkt aus Karlsruhe. Wir berichten von den wichtigsten Gerichtsentscheidungen am Bundesverfassungsgericht, am Bundesgerichtshof, dem EuGH und dem europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Wir Justizreporterinnen und Justizreporter sind vor Ort, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Folgen von Die Justizreporter*innen
250 Folgen
-
Folge vom 22.06.2023Gefangenenvergütung - Wie wenig ist zu wenig?
-
Folge vom 15.06.2023"Nachhaltigkeit und Klimaschutz" - Deutscher Anwaltstag 2023„Mit Recht nachhaltig“ – das ist das Motto des Deutschen Anwaltstags in Wiesbaden. Der Anwaltstag ist ein großer Fachkongress, der jährlich stattfindet, diesmal mit rund 2.000 Teilnehmern: vorwiegend Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, aber auch Vertreter aus Justiz, Politik und Wissenschaft, Jurastudentinnen und -studenten. Auf dem Anwaltstag wurde das Thema Nachhaltigkeit vielfältig thematisiert: Inwieweit kann ich den Klimaschutz als Menschenrecht geltend machen? Wie kann Umwelt- und Klimaschutz vor den Gerichten durchgesetzt werden? Wie schaffe ich es als Anwaltskanzlei, nachhaltiger zu werden, sprich mehr für den Klimaschutz zu tun? Wie können auch Anwält*innen als Dienstleister die vorhandenen Ressourcen möglichst schonend nutzen? Die Justizreporter*innen Elena Raddatz und Klaus Hempel waren vor Ort in Wiesbaden und haben mit Rechtsanwältin Dr. Roda Verheyen und Rechtsanwalt Stefan von Raumer über die Besonderheiten von Klimaklagen insbesondere am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg gesprochen. Außerdem berichten uns Ira Tsoures, Rechtsanwältin bei einer Berliner Großkanzlei, und Jan Lukas Kemperdiek, Rechtsanwalt bei einem Mittelständler, über die Herausforderung, eine Anwaltskanzlei nachhaltig zu führen.
-
Folge vom 09.06.2023Vergleich der Verfassungsgerichte auf der ganzen WeltWenn sie ihrem obersten Gericht vertrauen können, gibt das Menschen ein Gefühl von Sicherheit. Das gilt nicht nur für Deutschland, sondern für Demokratien auf der ganzen Welt. Aber was braucht es dafür? Die frühere Verfassungsrichterin Gertrude Lübbe-Wolff hat Verfassungsgerichte aus vielen verschiedenen Ländern verglichen. Die Aufhebung des Grundsatzurteils Roe v. Wade zu reproduktiven Rechten des U.S. Supreme Courts warf ein Schlaglicht auf die Ernennung von Richtern in den USA. Doch wie sieht dort die Entscheidungsfindung unter den Richtern aus? Und warum findet die richterliche Entscheidungsfindung in Brasilien öffentlich statt? Doch es sind nicht nur die großen Fragen, die Ausschlag geben, manchmal sind die Voraussetzungen für rechtsstaatliche und unabhängige Gerichte auch ganz handfest: Wer entscheidet, wie viele wissenschaftliche Mitarbeiter einem Richter zuarbeiten? Ist das etwa der Präsident, der damit seine Lieblinge im Gericht fördert? Der Überblick über die Verfassungsgerichte dieser Welt ist hochspannend. Gigi Deppe spricht mit Gertrude Lübbe-Wolff darüber, was ein echter Rechtsstaat unbedingt braucht.
-
Folge vom 01.06.2023Kinderehen vor GerichtZwangsverheiratet als 13-Jährige – so erging es auch Cennet Krishak, die sich am Ende aus ihrer Ehe befreien konnte. Um Kinder und Minderjährige hier in Deutschland zu schützen, hat der Gesetzgeber 2017 das "Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen" verabschiedet. Die wesentliche Neuregelung: Wenn ein Partner bei Eheschließung unter 16 Jahre alt war, sind im Ausland geschlossene Ehen hier automatisch unwirksam. Das Gesetz muss allerdings nachgebessert werden, befand das Bundesverfassungsgericht im März. Aber was genau muss geändert werden? Und was bedeutet das für die betroffenen, meist minderjährigen Mädchen? Und warum sollte man unterscheiden zwischen Früh- und Kinderehe? Darüber sprechen die Justizreporter Fabian Töpel und Christoph Kehlbach mit den beiden AutorInnen des Buches „Frühehe im Recht“, Prof. Dr. Nadjma Yassari und Prof. Dr. Ralf Michaels.
