Die Freiheit hat derzeit einen schweren Stand. Weltweit kämpfen Autokraten gegen die liberale Demokratie. Gleichzeitig erklingt in Krisenzeiten der Ruf nach einem starken Staat und nach mehr Verzicht. Hat der Liberalismus ausgedient? Yves Bossart im Gespräch mit dem Philosophen Michael Festl.
In allen Parteiprogrammen, von der rechten SVP über die wirtschaftsfreundliche FDP bis zur linken SP, steht der Wert der Freiheit weit oben. Doch alle Parteien verstehen etwas anderes darunter – ebenso wie unter dem Begriff «liberal». Was also ist liberal? Wie hängen wirtschaftlicher und politischer Liberalismus zusammen? Und wie könnte ein Liberalismus für das 21. Jahrhundert aussehen – angesichts von Kriegen, Klimakrise, Migration und Rechtspopulismus?
Über diese Fragen spricht Yves Bossart mit dem Philosophen Michael Festl, der meint: Der Liberalismus müsse sich neu erfinden – und sich gleichzeitig auf seine Wurzeln besinnen. Festl ist Professor im Bereich Philosophie an der Universität St. Gallen und beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit der Geschichte des politischen Liberalismus.
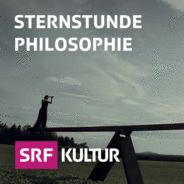
Kultur & GesellschaftWissenschaft & Technik
Sternstunde Philosophie Folgen
Vertiefende Gespräche mit herausragenden Persönlichkeiten aus Kultur, Wissenschaft und Politik. Die Sternstunde Philosophie vermittelt lebensnahe Denkanstösse zu zentralen Fragen unserer Zeit.
Folgen von Sternstunde Philosophie
100 Folgen
-
Folge vom 25.11.2023Liberalismus – Welche Freiheit wollen wir?
-
Folge vom 11.11.2023Sarah Bakewell – Humanisten leben erfüllter!Was ein gutes Leben ausmacht? Frei denken, furchtlos forschen, handelnd hoffen. Mit anderen Worten: als überzeugte Humanistin durchs Leben gehen. Das sagt die englische Denkerin und Bestsellerautorin Sarah Bakewell. Gespräch über eine Philosophie wahrer Menschlichkeit. Was braucht es, um gegenwärtigen Krisen geistig zu begegnen? In Zeiten religiöser Konflikte, medialer Revolutionen, neuer Technologien und auch pandemischer Bedrohungen? Bereits vor mehr als 700 Jahren stellten sich Menschen diese Fragen mit neuer Dringlichkeit. Und hoben von Norditalien mit dem Humanismus eine neue Denktradition aus der Taufe. In deren Zentrum sollten nicht mehr theologische Dogmen stehen, sondern der freie, einsichtsreiche Mensch – seine einzigartigen Talente, Techniken und Sehnsüchte. Die britische Schriftstellerin Sarah Bakewell, Autorin weltweit gefeierter Werke wie «Das Café der Existenzialisten» sowie «Das Leben Montaignes» sieht in der Tradition des Humanismus den Schlüssel zu einer besseren Zukunft: selbstbestimmt, verantwortungsvoll, nachhaltig, emanzipatorisch. Der Titel ihres aktuellen Werkes lautet deshalb «Wie man Mensch wird – Auf den Spuren der Humanisten». Im Gespräch mit Wolfram Eilenberger entwickelt sie, welche rettenden Einsichten Humanisten für unsere Gegenwart bereithalten.
-
Folge vom 04.11.2023Woher kommt der Hass gegen die Hässlichkeit?Zu dick, zu alt, zu dunkel, zu haarig: Wer nicht der Norm entspricht, wird gemobbt und diskriminiert. Schönheit hingegen verspricht Erfolg und Anerkennung. Doch wer definiert, was schön ist? Und welche Machtstrukturen stecken hinter dem Hass gegen die Hässlichkeit? Frisch gespritzt und neu gepolstert: Im Pro-Kopf-Vergleich gehört die Schweiz zu den führenden Ländern, was Schönheitseingriffe betrifft. Und je mehr Menschen mitmachen, desto verbindlicher wird die Selbstoptimierung. Die Künstlerin Moshtari Hilal und die Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Lechner zeigen auf, wie viel Politik in unseren Schönheitsidealen steckt und fordern mehr Widerstand: Wir sollten nicht die eigenen Körper kritisieren, sondern das System, die Säulen, auf denen die Schönheitsindustrie fusst: Kapitalismus, Patriarchat, Kolonialismus und Rassismus. Doch wie sähe eine solche Schönheitsrevolution aus? Wie gelänge eine inklusivere Gesellschaft, die keine Hässlichkeit mehr braucht? Und was spricht eigentlich gegen Schönheits-OPs? Über diese Fragen spricht Yves Bossart mit Moshtari Hilal, Künstlerin und Autorin des Buches «Hässlichkeit», und mit Elisabeth Lechner, Kulturwissenschaftlerin und Autorin des Buches «Riot, dont diet! – Aufstand der widerspenstigen Körper».
-
Folge vom 28.10.2023Omri Boehm, lässt sich ohne Hass über Nahost sprechen?Die Terrorattacke der Hamas wird einhellig verurteilt. Gerade bei westlichen Intellektuellen wird sie aber teilweise von einem «ja, aber» sekundiert, was wiederum für Empörung sorgt. Wie lässt sich über die Situation in Nahost sprechen und ist ein Weg aus dieser Spirale des Hasses überhaupt möglich? Das Grauen, das die Hamas-Terroristen mit ihrer unglaublich brutalen Attacke gegenüber unschuldigen Israelis angerichtet haben, ist kaum in Worte zu fassen, und das Reden darüber fällt schwer. Der Angriff wird in aller Schärfe verurteilt, einige schieben jedoch ein «ja, aber» nach, wollen den Terror kontextualisieren und verweisen auf die humanitäre Katastrophe im Gaza. Droht damit eine Verharmlosung, gar Rechtfertigung, und lässt sich das «akut Böse» überhaupt kontextualisieren? Andererseits: Lässt sich Terror losgelöst von einem Kontext beurteilen? Warum scheint es gerade so schwer, diskursiv zu trennen zwischen Israel-Kritik und Antisemitismus, und wann ist diese Fähigkeit zur Differenzierung abhandengekommen? Wie kann ein Ausbruch aus dem Denken der Vergeltung hin zur Vergebung gelingen, wenn Unrecht und Schuld so tief eingegraben sind? Zu Gast ist der deutsch-israelische Philosoph Omri Boehm, Professor an der renommierten New School for Social Research in New York, der die Zweitstaatenlösung als definitiv gescheitert bezeichnet und der 2020 in seinem Buch «Israel – Eine Utopie» eine binationale Republik auf dem Gebiet des heutigen Israels und Palästina vorgeschlagen hat. Mit Omri Boehm sprechen Barbara Bleisch und Wolfram Eilenberger.
