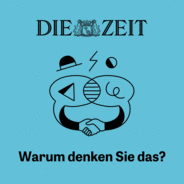
Nachrichten
Warum denken Sie das? Folgen
Zwei Menschen sitzen sich gegenüber. Beide sind in einer politischen Frage völlig anderer Meinung: beim Impfen, in der Frage, wie der Westen mit Russland umgehen sollte, oder ob Gendern mehr Gerechtigkeit bringt. Beide haben Mühe zu begreifen, warum das Gegenüber solche Positionen vertritt. Dennoch versuchen sie in einem Gespräch zu verstehen, wie die andere Person zu ihren Ansichten kam. Das ist die Idee von “Warum denken Sie das?” Jana Simon und Philip Faigle treffen in jeder Folge zwei Menschen, die in einer Frage vollkommen unterschiedlich denken. Sie besuchen die Gäste des Podcasts zu Hause, um zu erfahren, wie ihre Biographien ihr Denken geprägt haben und wie sie zu ihren Ansichten gelangt sind. Anschließend begegnen sich die beiden Antagonisten im Studio zum ersten Mal und versuchen zu ergründen, ob es nicht doch etwas gibt, was sie verbindet. Dieser Podcast wird produziert von Pool Artists. Falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos Die ZEIT: www.zeit.de/podcast-abo
Folgen von Warum denken Sie das?
-
Folge vom 12.06.2022"Machen Sie doch Ihre Friedensdemos vor dem Kreml!"In der achten Folge unseres Podcasts "Warum denken Sie das?" geht es um Krieg und Frieden und um Fragen, die in Deutschland gerade emotional diskutiert werden, wie: Soll die Bundesregierung schwere Waffen an die Ukraine liefern? Können Waffen Frieden schaffen? Oder tragen Waffenlieferungen im Gegenteil zu einer weiteren Eskalation des Konflikts bei? Wie immer treffen im Studio in Berlin zwei Menschen aufeinander, die sich unversöhnlich gegenüberstehen und die Mühe haben, zu verstehen, wie die andere Seite zu ihren Überzeugungen gelangt ist. Die Ärztin und Friedensaktivistin Angelika Claussen engagiert sich bereits seit vielen Jahrzehnten in der deutschen Friedensbewegung. Sie ist Co-Vorsitzende der Organisation Internationale Ärzt*innen für die Verhütung des Atomkrieges (IPPNW) in Deutschland. Sie ist strikt gegen die Waffenlieferungen an die Ukraine, weil sie fürchtet, dass dies den Konflikt weiter eskaliert. Sie hat auch den offenen Brief der Zeitschrift "Emma" unterzeichnet, der sich gegen Waffenlieferungen an die Ukraine wendet. Ihr gegenüber sitzt Ilko-Sascha Kowalczuk. Er ist Historiker, Buchautor und arbeitet beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der DDR. Sein Großvater väterlicherseits stammt aus der Ukraine. Kowalczuk befürwortet Waffenlieferungen an die Ukraine, weil für ihn die Freiheit und das Selbstbestimmungsrecht der Ukraine schwerer wiegen als Frieden um jeden Preis. Er hat den offenen Brief von Intellektuellen unterschrieben, die sich für kontinuierliche Waffenlieferungen an die Ukraine einsetzen. [ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner finden Sie HIER. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcast-Abo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.
-
Folge vom 28.04.2022"Dass die Kernenergie sicher ist, werden Sie von mir nicht hören"In der siebten Folge von Warum denken Sie das? geht es um eine Streitfrage, die in Deutschland eigentlich entschieden war, in der aktuellen Energiekrise aber wieder auf der Agenda ist: Ist es richtig, aus der Atomkraft auszusteigen? Oder war der Atomausstieg im Gegenteil ein großer Fehler? Im Studio von Warum denken Sie das? treffen dabei zwei Menschen aufeinander, die ihr Leben mit diesem Streitthema verbracht haben. Auf der einen Seite ist Wolfgang Ehmke, 74 Jahre alt, gelernter Lehrer und Atomkraftgegner aus dem Wendland, der sein Leben dem Kampf gegen die Atomkraft gewidmet hat. Auf der anderen Seite steht Ulrich Waas, ebenfalls 74 Jahre alt. Er ist Physiker und hat bis zu seiner Pensionierung für Siemens und bei einem Kraftwerksbetreiber gearbeitet und hält den Atomausstieg technisch, wissenschaftlich und auch ökologisch für einen Fehler. Beide Männer wurden im selben Jahr geboren, standen zeit ihres Lebens auf zwei Seiten des Konflikts und begegnen sich nun im Studio in Berlin zum ersten Mal. Es wird ein kontroverses Gespräch, das auch zeigt, wie komplex und schwierig die Energiedebatte bis heute ist. [ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner finden Sie HIER. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcast-Abo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.
-
Folge vom 15.03.2022"Russisch ist nicht gleich Russland und nicht gleich Putin"Die sechste Folge unseres Podcast "Warum denken Sie das?" ist eine Sonderfolge. Es geht um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Anders als sonst treffen nicht zwei Menschen zusammen, die in einer Frage sehr unterschiedlich denken. Stattdessen begegnen sich im Studio zwei Gesprächspartner, die beide vor Jahren ihr Land verließen und die nun von Deutschland aus Russlands Angriffskrieg miterleben müssen. So unterschiedlich ihre Biografien auch sein mögen – in der Frage des Krieges sind sich einig: Er muss sofort gestoppt werden. Mascha Kritchevski, 49 Jahre alt, wurde in Leningrad, dem heutigen Sankt Petersburg, geboren. Sie kam bereits 1990 nach Deutschland und studierte in Düsseldorf Germanistik und Amerikanistik, anschließend zog sie nach Berlin. Dort fing sie als Moderatorin bei Radio Russkij Berlin an, einem Berliner Sender für die russischsprachige Bevölkerung. Vor wenigen Tagen hat sich der Sender wegen des Krieges in der Ukraine umbenannt – das "Russkij" verschwindet fortan aus dem Namen. Kritchevski ist entsetzt und beschämt über den Angriffskrieg Putins. Zugleich berichtet sie von einer zunehmenden Russen-Feindlichkeit in Berlin. Oleksii Isakov wurde 1986 in Odessa in der Ukraine geboren. Vor zehn Jahren kam er zum Studium der interkulturellen Kommunikation nach Deutschland und blieb. Heute schreibt er an der Viadrina-Universität in Frankfurt (Oder) an seiner Doktorarbeit und koordinierte bis zum Krieg den Austausch mit Studierenden aus der Ukraine, Georgien, Kosovo und aus Russland. Seine Eltern leben noch immer in Odessa. Isakov fürchtet angesichts des Vormarschs der russischen Armee um das Leben seiner Familie. [ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner finden Sie HIER. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcast-Abo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.
-
Folge vom 24.02.2022Fleischkonsum: "Es ist ein System der Gewalt"Ist die Fleischproduktion in Deutschland insgesamt ein Missstand und sollte deshalb abgeschafft, verändert oder zumindest drastisch verringert werden? Darf der Mensch überhaupt Tiere halten und töten, um sie zu essen? In der fünften Folge unseres Podcasts "Warum denken Sie das?" treffen zwei Menschen aufeinander, die in diesen Fragen sehr unterschiedliche Positionen vertreten. Der Schweinehalter Thorsten Riggert betreibt in einem kleinen Ort in Niedersachsen seit mehr als 20 Jahren eine konventionelle Schweinemast, so wie zuvor schon seine Eltern und Großeltern. Er findet, dass Menschen selbstverständlich Tiere töten dürfen, um sie zu essen, und verteidigt auch die heutige Form der Tierhaltung. Zugleich ist er offen für Reformen und setzt Hoffnungen in den neuen Landwirtschaftsminister Cem Özdemir. Ganz anders blickt die Tierschutzaktivistin, Philosophin und Buchautorin Friederike Schmitz auf das System der Fleischindustrie. Seit Jahren kämpft sie dagegen und fordert nicht nur eine radikale Reform der Tierhaltung, sondern einen weitgehenden Ausstieg aus der Fleischproduktion. Sie ist außerdem der Ansicht, dass es unmoralisch ist, Tiere zu töten, um sie zu essen. Und Schmitz beteiligte sich auch an Protestaktionen von Tierschutzaktivisten gegen Betreiber von Ställen. Schmitz und Riggert begegnen sich im Podcaststudio in Berlin zum ersten Mal. Es ist ein sehr kontroverses Gespräch, in dem beide Seiten nur wenige Gemeinsamkeiten entdecken können. Und doch ist der Dialog vom Versuch geprägt, die andere Seite besser zu verstehen. [ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner finden Sie HIER. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcast-Abo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.
