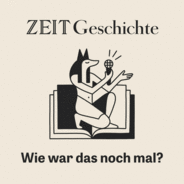
Kultur & Gesellschaft
ZEIT Geschichte. Wie war das noch mal? Folgen
Wo war die Varusschlacht? Was steckt hinter dem Mythos der Hanse? War Helmut Kohl ein großer Kanzler? Und wo sind eigentlich die Frauen in der Geschichte? Wir stellen Fragen an die Vergangenheit, beleuchten Ereignisse und Persönlichkeiten – und zeigen, was das alles mit heute zu tun hat. Jeden Monat neu zum Thema des aktuellen Hefts von ZEIT Geschichte. Die Hosts von "Wie war das noch mal?", Markus Flohr und Judith Scholter, haben zusammen in Hamburg Geschichte studiert, Geschichten geschrieben und sind nun Redakteur und Redakteurin bei ZEIT Geschichte. Falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos Die ZEIT: www.zeit.de/podcast-abo
Folgen von ZEIT Geschichte. Wie war das noch mal?
-
Folge vom 20.12.2025Wie kam Jesus in den Koran?Es ist die Sure 19, die Maria, der Mutter Jesu, gewidmet ist. Sie erzählt, wie Maria ihren Sohn auf die Welt bringt – und sofort kann er sprechen. Ein Wunder. Doch wer ist dieser Jesus des Korans eigentlich und wie führte sein Weg in Mohammeds Offenbarung? Welche Rolle spielt seine Mutter Maria? Die neue Folge von Wie war das noch mal? begibt sich auf eine geschichtlich-theologische Suche in die Welt der Spätantike, nach Mekka und Medina, in die Lebenszeit Mohammeds zu Beginn des siebten Jahrhunderts. Gemeinsam mit dem islamischen Theologen und Religionspädagogen Mouhanad Khorchide aus Münster spüren wir der Frage nach, welche Rolle das Christentum der arabischen Halbinsel für die ersten Muslime spielte, was Mohammed von Jesus gehört hatte und welche Rolle Jesus in seiner Offenbarung spielte. Wir entdecken, dass Christentum und Islam nicht immer in Konkurrenz und Feindschaft zueinander standen, sondern dass Mohammed sich und seine Botschaft vielmehr in einer Tradition mit Jesus, aber auch mit den jüdischen Urvätern Abraham und Mose sieht. Und wir wollen wissen, was wir heute daraus lernen können, dass "Jesus, Sohn der Maria", eine prominente Figur im Koran ist. Unser neues Heft Christentum und Islam bekommen Sie online im ZEIT Shop oder im Handel. Die Redaktion erreichen Sie per Mail unter zeitgeschichte@zeit.de. Für unsere Sendung haben wir folgende Literatur benutzt, die wir gerne empfehlen möchten: - Mouhanad Khorchide: Der andere Prophet. Jesus im Koran, Herder Verlag - Martin Bauschke: Der Sohn Marias: Jesus im Koran, Lambert Schneider/WBG - Karl-Josef Kuschel: "Dass wir alle Kinder Abrahams sind ...": Helmut Schmidt begegnet Anwar as-Sadat, Herder Verlag - Gudrun Krämer: Geschichte des Islam, C.H. Beck Verlag Ab sofort sind Teile des Archivs von "ZEIT Geschichte" nur noch exklusiv mit einem Digitalabo der ZEIT zu hören – auf zeit.de, auf Apple Podcasts und auf Spotify. Ein kostenloses Probeabo können Sie hier abschließen. Zu unserem vergünstigen Podcastabo geht es hier. Wie Sie Ihr bestehendes Abo mit Spotify oder Apple Podcasts verbinden, lesen Sie hier. Hier können Sie eine aktuelle Gratisausgabe von ZEIT Geschichte zum Testen bestellen. Sie bekommen das Heft zum Bauernkrieg, aber auch viele andere, im Handel oder online im ZEIT Shop. [ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner finden Sie HIER. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcast-Abo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.
-
Folge vom 29.11.2025„Gott will es“: Die Kreuzzüge und die islamische WeltIm November 1095 ruft Papst Urban II. zum Kreuzzug auf. Auf dem Konzil von Clermont hält er eine Predigt vor fast 200 Erzbischöfen, Bischöfen und Äbten, immer wieder wird er von Rufen unterbrochen: „Deus lo vult!“, „Gott will es!“ In mehreren großen Gruppen finden sich Ritter, Bauern oder Tagelöhner zusammen, um Richtung Jerusalem zu ziehen. Rund dreieinhalb Jahre später erobert ein christliches Heer die Heilige Stadt von den muslimischen Fatimiden, verübt ein grausames Massaker an den muslimischen und jüdischen Einwohnern und errichtet einen Kreuzfahrerstaat: das Königreich Jerusalem. Immer wieder wird der Kreuzzug als tiefer Einschnitt in die Beziehung von Islam und Christentum gewertet, als blutiger Dreh- und Angelpunkt ihrer gemeinsamen Geschichte. Doch stimmt dieser Befund? Welches Echo fanden die Kreuzzüge damals in der islamischen Welt? In der neuen Folge von „Wie war das noch mal?“ gehen wir dieser Frage nach. Auch das aktuelle Heft von ZEIT Geschichte dreht sich um die Geschichte von Christentum und Islam, die oft zu einer Erzählung von ewiger Feindschaft stilisiert wird. Was ist echter Konflikt, was Mythos? Vom Leben Mohammeds bis in die Gegenwart spüren wir dieser Frage nach: Wieso büßte die muslimische Welt ihren zivilisatorischen Vorsprung ein? Was dachte Luther über den Islam? Und trug der europäische Kolonialismus zur Entstehung des Islamismus bei? Die Einspielung des Palästinalieds von Walther von der Vogelweide stammt von der Sängerin Korydwenn. Es ist hier zu finden. Sie bekommen das Heft online im ZEIT Shop oder im Handel. Unter diesem Link können Sie eine Gratisausgabe von ZEIT Geschichte zum Testen bestellen. Die Redaktion erreichen Sie per Mail unter zeitgeschichte@zeit.de. Ab sofort sind Teile des Archivs von "ZEIT Geschichte" nur noch exklusiv mit einem Digitalabo der ZEIT zu hören – auf zeit.de, auf Apple Podcasts und auf Spotify. Ein kostenloses Probeabo können Sie hier abschließen. Zu unserem vergünstigen Podcastabo geht es hier. Wie Sie Ihr bestehendes Abo mit Spotify oder Apple Podcasts verbinden, lesen Sie hier. Hier können Sie eine aktuelle Gratisausgabe von ZEIT Geschichte zum Testen bestellen. Sie bekommen das Heft zum Bauernkrieg, aber auch viele andere, im Handel oder online im ZEIT Shop. [ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner finden Sie HIER. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcast-Abo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.
-
Folge vom 25.10.2025Im Geist der Wehrmacht? Wie vor 70 Jahren die Bundeswehr entstand (Teil 1)Am 20. Januar 1956 haben sich die ersten etwa 1000 Soldaten der neuen westdeutschen Streitkräfte in Andernach in Rheinland-Pfalz versammelt. Sie erwarten hohen Besuch, der Bundeskanzler hat sich angekündigt. Konrad Adenauer kann die Visite in Andernach als großen Erfolg verbuchen: Nur zehn Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs darf die Bundesrepublik im Rahmen der Nato eigene Streitkräfte aufstellen. Das Besatzungsstatut ist aufgehoben worden und Westdeutschland mit wenigen Einschränkungen wieder souverän. "Soldaten", hebt Adenauer in seiner Ansprache an die noch namenlose Truppe an: "Sie stehen vor einer Aufgabe, die durch manche Schatten der Vergangenheit und Probleme der Gegenwart besonders schwierig ist. Das deutsche Volk erwartet von Ihnen, dass Sie in treuer Pflichterfüllung Ihre ganze Kraft einsetzen für das über allem stehende Ziel, in Gemeinschaft mit unseren Verbündeten den Frieden zu sichern." Den "Schatten der Vergangenheit", die über der Gründung der Bundeswehr liegen, spüren wir in diesem ersten Teil unserer Doppelfolge von "Wie war das noch mal" nach. Denn deutsche Soldaten nur wenige Jahre nach Kriegsende, das bedeutet zwangsläufig, dass man beim Aufbau der Streitkräfte auf ehemalige Angehörige der Wehrmacht angewiesen ist. Aber wie viel Wehrmacht genau steckt in der neuen Bundeswehr? Um diese Frage zu beantworten, lernen wir Hans Speidel und Adolf Heusinger kennen, zwei ehemalige Generäle Hitlers, die schon im Jahr 1950 bei ersten konspirativen Planspielen für eine bundesdeutsche Armee mitmischen und die bald Führungsposten in der neuen Bundeswehr bekleiden. Wir erzählen von der geheimen Schnez-Truppe, einer Schattenarmee ehemaliger Wehrmachtssoldaten, die gegen den Kommunismus kämpfen wollte, und davon, wie der Wehrmachtsveteran Wolf Graf von Baudissin ein neues Soldatenbild entwirft, das den Geist des Grundgesetzes atmet und die Bundeswehr bis heute prägt. Und wir beleuchten, wie beinahe alles anders gekommen wäre: Bevor die Bundeswehr gegründet wurde, verhandeln Adenauer und die Alliierten über eine europäische Armee. Der zweite Teil dieser Doppelfolge wird sich mit den großen Debatten nach der Gründung der Bundeswehr beschäftigen. Denn schon vor 70 Jahren stand die Bundesrepublik vor der Aufgabe, aus dem Stand Tausende neue Soldaten aufzustellen. Ob es dazu einer Wehrpflicht bedürfe, darüber haben sich schon in den Fünfzigerjahren die Geister geschieden. Der zweite Teil ist im Abobereich zu finden, wo Sie unsere Arbeit unterstützen können. Auch das aktuelle Heft von ZEIT Geschichte dreht sich um die Geschichte der Bundeswehr seit ihrer Gründung vor 70 Jahren und um die Fragen, die seit Putins zweitem Überfall auf die Ukraine wieder mit Wucht auf die Tagesordnung zurückgekehrt sind. Wir zeigen in der neuen Ausgabe, dass es in der Geschichte der Bundeswehr nicht nur eine, sondern viele Zeitenwenden gegeben hat. Nach dem Ende des Kalten Krieges wurde aus einer Truppe zur Landes- und Bündnisverteidigung eine weltweit operierende Einsatzarmee. Und zum ersten Mal seit 1945 starben nun auch wieder Soldaten im Gefecht, so wie der Hauptgefreite Sergej Motz, dessen Geschichte unser Heft erzählt. Unter www.zeit.de/geschichte-bundeswehr können Sie uns abonnieren. Das Heft über die Bundeswehr bekommen Sie dann als erste Ausgabe gratis. Alle Folgen des Podcasts hören Sie hier. Die Redaktion erreichen Sie per Mail unter zeitgeschichte@zeit.de Ab sofort sind Teile des Archivs von "ZEIT Geschichte" nur noch exklusiv mit einem Digitalabo der ZEIT zu hören – auf zeit.de, auf Apple Podcasts und auf Spotify. Ein kostenloses Probeabo können Sie hier abschließen. Zu unserem vergünstigen Podcastabo geht es hier. Wie Sie Ihr bestehendes Abo mit Spotify oder Apple Podcasts verbinden, lesen Sie hier. Hier können Sie eine aktuelle Gratisausgabe von ZEIT Geschichte zum Testen bestellen. Sie bekommen das Heft zum Bauernkrieg, aber auch viele andere, im Handel oder online im ZEIT Shop. [ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner finden Sie HIER. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcast-Abo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.
-
Folge vom 27.09.2025Der Starfighter-SkandalAm 19. Juni 1962 stürzen vier Piloten westlich von Köln mit ihren Kampfflugzeugen ab. Gerade erst hat die Luftwaffe die Maschinen eingeführt, die Piloten trainieren für eine Flugshow am nächsten Tag. Alle vier Männer sterben bei dem Absturz unweit des Luftwaffen-Stützpunkts Nörvenich. Es ist die erste Katastrophe dieser Art in der Bundesrepublik. Die Flugshow am Folgetag wird abgesagt. Eigentlich sollte gefeiert werden, dass an diesem Standort der neue Allzweck-Kampfjet der Bundeswehr in Dienst gestellt wird: der Starfighter. Nun liegen vier Exemplare zerstört am Boden. In der neuen Folge von "Wie war das noch mal?" nehmen wir Platz in einem aufregenden Flugzeug, das mit doppelter Schallgeschwindigkeit flog, der Bundeswehr Schlagkraft und Modernität bringen sollte und geradezu sinnbildlich für die Nachkriegs-Allianz mit den USA stand. Doch der Starfighter war auch bald berüchtigt für seine Abstürze und Pannen. Er kostete viel zu viele junge Piloten das Leben. Zudem sorgte er für eine aufsehenerregende Schmiergeld-Affäre. Es gibt kein Flugzeug der Bundeswehr, das so bekannt ist, keines hat einen so ambivalenten Ruf. Wir zeichnen die Geschichte des Starfighters nach und begeben uns in die Zeit kurz nach der Gründung der Bundeswehr. Warum entschied der CSU-Verteidigungsminister Franz Josef Strauß im Jahr 1958, ausgerechnet diesen Kampfjet zu kaufen? Wir rekapitulieren die Pannenserie und die zahlreichen Abstürze, die 1965 und 1966 zu einer heftigen politischen Krise in Regierung und Parlament in Bonn führten. Wir lassen uns vom Starfighter-Piloten Klaus Sommer erzählen, wie schwierig es wirklich war, diesen Jet zu fliegen, und wie es sich anfühlte, im Cockpit zu sitzen – mit einer Atombombe unter dem Rumpf. Sommer erinnert sich wie die meisten Starfighter-Piloten trotz allem gerne an den Kampfjet: Er war "das Beste, was einem passieren konnte", sagt er, "wenn man es überlebte". Auch das aktuelle Heft von ZEIT Geschichte widmet sich der Bundeswehr, die im November ihren 70. Geburtstag feiert: Darin analysiert der Militärhistoriker Sönke Neitzel, dass die deutsche Armee wieder zu ihrer ursprünglichen Aufgabe der Landesverteidigung zurückfinden muss. Der Historiker und ZEIT-Geschichte-Autor Norbert Frei erzählt, wie Konrad Adenauer den Alliierten die Wiederbewaffnung abgerungen hat. Moritz Gerlach geht der Frage nach, ob und wann die Bundeswehr eigentlich in der Lage war, das Land zu verteidigen. Und unsere Autorin Magdalena Gräfe hat die Geschichte des Hauptgefreiten Sergej Motz nachgezeichnet, der 2009 in Afghanistan starb – als erster deutscher Soldat, der nach 1945 in einem Feuergefecht bei einem Kampfeinsatz ums Leben kam. Sie erhalten das Heft online im ZEIT Shop oder im Handel. Unter diesem Link können Sie eine Gratisausgabe von ZEIT Geschichte zum Testen bestellen. Alle Folgen des Podcasts hören Sie hier. Die Redaktion erreichen Sie per Mail unter zeitgeschichte@zeit.de. Für unsere Sendung haben wir uns Rat und Auskunft beim Deutschen Museum in München geholt. Dort hat uns der Kurator Andreas Hempfer aus der Hauptabteilung Verkehr, Mobilität, Transport viele wertvolle Hinweise gegeben. Das Deutsche Museum zeigt in seiner Hauptausstellung auf der Museumsinsel einen Starfighter sowie einen weiteren in seiner Außenstelle in Oberschleißheim. www.deutsches-museum.de Die Plenarsitzungen des Deutschen Bundestags sind in Text, Bild und Ton auf seiner Internetseite dokumentiert und recherchierbar: www.bundestag.de/mediathek/plenarsitzungen Ab sofort sind Teile des Archivs von "ZEIT Geschichte" nur noch exklusiv mit einem Digitalabo der ZEIT zu hören – auf zeit.de, auf Apple Podcasts und auf Spotify. Ein kostenloses Probeabo können Sie hier abschließen. Zu unserem vergünstigen Podcastabo geht es hier. Wie Sie Ihr bestehendes Abo mit Spotify oder Apple Podcasts verbinden, lesen Sie hier. Hier können Sie eine aktuelle Gratisausgabe von ZEIT Geschichte zum Testen bestellen. Sie bekommen das Heft zum Bauernkrieg, aber auch viele andere, im Handel oder online im ZEIT Shop. [ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner finden Sie HIER. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcast-Abo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.
