In welcher Vorstellung von Zeit leben wir, beziehungsweise lebten wir? Die Vorstellung von Zeit, Geschichte, Vergangenheit und Zukunft einer Gesellschaft oder einer Kultur ist eine wesentliche Frage für den Umgang mit Erkenntnis, Technologie und Politik. Dies ist historisch interessant hat aber ebenso erhebliche Auswirkungen auf die Art und Weise wie sich technischer und wirtschaftlicher Fortschritt entwickelt und unsere heutige Kultur gestaltet hat. Wie gehen wir mit unserer Zukunft um? Das hängt in starkem Maße von unserem Bild der Zeit ab.
Eine lineare Zeit mit Vergangenheit und offener Zukunft, die vor allem auch von Menschen beeinflussbar und gestaltbar ist eher eine moderne, zeitgemäße Vorstellung von Zeit, die wir nicht in allen Epochen der menschlichen Entwicklung finden. Vor der Aufklärung war etwa die europäische Kultur sehr an der Antike sowie an religiösen Mythen orientiert:
»Früher war nicht einfach nur alles besser, sehr viel früher war sogar nahezu alles perfekt.«, Achim Landwehr
Also ein Leben in der Orientierung einer vermeintlich perfekten Vergangenheit:
»Der Fortschritt musste also immer ein Rückschritt sein zu den Alten, den Antiken, den Vorfahren«, Achim Landwehr
Philip Blom schreibt, Ende 16. Jahrhundert sah man die »ruina mundi« kommen, den Untergang der Welt. Natürliche Beobachtungen wurden durch Zitate Bibel begründet, Naturkatastrophen theologisch interpretiert.
»Seit der Antike gilt: es ist egal wann sie geboren sind oder sterben, es läuft immer dasselbe Stück – Dies stimmt seit 200 Jahren nun nicht mehr.«, Peter Sloterdijk
Erst ab 1700 wird es für die Menschen erst langsam zur Möglichkeit, dass sich die Zukunft durch eigenes Handeln beeinflussen lässt. Moderne Wissenschaft beginnt sich somit in etwa ab der Neuzeit zu entwickeln und die empirischen Wissenschaften, wie Physik und Chemie beginnen langsam Form anzunehmen und nehmen ab dem 18. und 19. Jahrhundert enorm an Fahrt auf.
Heute leben wir in zahlreichen Widersprüchen, zwischen der Alternativlosigkeit politischer und wirtschaftlicher Entscheidungen, der Hilflosigkeit bei ethisch schwierigen Fragen und einem neuen Hyper-Individualismus. Welche Rolle kann der Einzelne überhaupt noch wahrnehmen?
»Tatsächlich glauben die meisten Menschen in den reichen Ländern, daß es ihren Kindern schlechter gehen wird als ihnen.« Rutger Bregman, Zygmunt Bauman
Der Philosoph Byung-Chul Han beobachtet:
»Wir leben in einer besonderen historische Phase, in der die Freiheit selbst Zwänge hervorruft. Die Freiheit des Könnens erzeugt sogar mehr Zwänge als das disziplinarische Sollen, das Gebote und Verbote ausspricht. Das Soll hat eine Grenze. Das Kann hat dagegen keine.«
Wir leben, so hat es den Anschein, zwischen Verwirrung, vermeintlichem Zwang und fragwürdigen Retropien.
Aber ist das alles überhaupt begründet? Gibt es einen Ausweg aus diesem Dilemma?
Referenzen
Zeitvorstellung
Thomas Maissen, Vom Werden der Zukunft, Spektrum der Wissenschaft, September 2010
Achim Landwehr, Geburt der Gegenwart: Eine Geschichte der Zeit im 17. Jahrhundert
Philip Blom, Die Welt aus den Angeln
Zygmunt Bauman, Retrotopia
Rushkoff, Douglas. Present Shock: When Everything Happens Now
Peter Sloterdijk, Gespräch in den Sternstunden Philosophie
Weitere Referenzen
Carl Becker, die Welt von Morgen
Byung-Chul Han, Psychopolitik
Yuval Harari, Homo Deus
Jared Diamond: Lessons from Hunter-Gatherers
Shoshana Zuboff, Surveillance Capitalism
Pierre Casse, Leadership without concessions (2015)
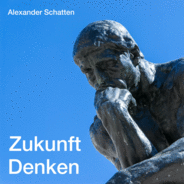
Kultur & GesellschaftBildungWissenschaft & Technik
Zukunft Denken – Podcast Folgen
Woher kommen wir, wo stehen wir und wie finden wir unsere Zukunft wieder?
Folgen von Zukunft Denken – Podcast
132 Folgen
-
Folge vom 17.10.2019012 - Wie wir die Zukunft entdeckt und wieder verloren haben
-
Folge vom 11.09.2019011 - Ethik, oder: Warum wir Wissenschaft nicht den Wissenschaftern überlassen sollten!Ethik und Wissenschaft – eine überflüssige Episode? Es gibt Wissenschafter, die sich auf die Position zurückziehen: Wissenschaft wäre nur Erkenntnisgewinn, Ethik beginnt bestenfalls mit der Anwendung. Ethik und Philosophie wären recht überflüssige Tätigkeiten, lästig und nicht hilfreich. Ich teile diese Ansicht nicht – ich hoffe auch Sie nicht, nachdem Sie diese Episode gehört haben. Zwei Thesen zu Beginn: Nassim Taleb: »Wissenschaft ist großartig, aber einzelne Wissenschafter sind gefährlich« Daraus folgt aus meiner Sicht: wir dürfen Wissenschaft als Gesellschaft keinesfalls den Wissenschaftern alleine überlassen sondern müssen uns energisch einbringen Warum ist das so? Wir beginnen mit einem kurzen Blick in die jüngere Vergangenheit bevor wir uns in die Gegenwart und Zukunft begeben. Dazu drei wesentliche Aspekte: Erkenntnisse die unter ethisch sehr fragwürdigen Rahmenbedingungen entstanden sind (»Nazi« Forschung, Experimente an Menschen in den 1960er und 1970er Jahren!) – wie gehen wir damit um? Wissenschafter mit problematischen politischen oder ethischen Ansichten (wie Martin Heidegger, Johannes Stark und Philipp Lenard, die Agitatoren einer deutschen versus »jüdischen« Physik) Und der Blick in Gegenwart und Zukunft: wie gehen wir mit dem enormen Potential wissenschaftlicher Möglichkeiten um, die aber ethisch umstritten sind, z.B. die Stammzellenforschung, aber auch mit ethischen Herausforderungen, die sich aus unserem kapitalistischen System ergeben. Dies betrifft etwa die Pharma-Industrie, aber auch sehr stark die Digitalisierung und Innovationen im Bereich der Informatik. In 20 Minuten wie immer, ein erster Gedankengang, den wir später noch vertiefen können. Referenzen Eduard Pernkopf und der medizinische Atlas Gustav Spann, Untersuchungen zur Anatomischen Wissenschaft in Wien 19381945, Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes, Jahrbuch 1999 Chris Hubbard, Eduard Pernkopf’s atlas of topographical and applied human anatomy: The continuing ethical controversy, The Anatomical Record, Volume 265, Issue 5, pages 207–211, 15 October 2001 William E. Seidelman, Medicine and Murder in the Third Reich, Jewish Virtual Library Eduard Pernkopf in SA Uniform und Hitlergruß vor der Vorlesung (Dokumentationsarchiv des österr. Widerstands) Mary Roach, Stiff: The Curious Lives of Human Cadavers, W. W. Norton & Company (May 2004) Tuskegee Syphillis Studie CDC Zusammenfassung (inkl. Entschuldigung des US Präsidenten Bill Clinton 1997) Christian Reinboth, Das Tuskegee-Experiment und die Grenzen medizinischer Forschung Jüdische Physik und »Nazi-Wissenschafter« SEP: Martin Heidegger Armin Hermann, die Jahrhundertwissenschaft; Werner Heisenberg und die Geschichte der Atomphysik, rororo (1993) Nobel Prize: Philipp Lenard Nobel Prize: Johannes Stark beachten Sie die nur minimale Erwähnung der Thematik in der Vorstellung der Wissenschafter auf den Seiten des Nobelpreises. Digitalisierung Shoshana Zuboff, Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus (2018) Moshe Y. Vardi, To Serve, Communications of the ACM, July 2019, Vol. 62 No. 7, Page 7 Verschiedenes Nassim Taleb, Fooled by Randomness, Penguin (2007)
-
Folge vom 26.08.2019010 - Komplizierte Komplexität”Wie alles sich zum Ganzen webt, Eins in dem andern wirkt und lebt“, Goethe, Faust, erste Szene Ich habe in vorigen Episoden immer wieder den Begriff der »Komplexität« verwendet. Es ist daher höchst an der Zeit dass wir uns eine erste Episode mit diesem Begriff auseinandersetzen. In dieser Episode stelle ich drei Fragen: Ist Komplexität und Kompliziertheit dasselbe? Was ist Komplexität, genauer: wo finden wir komplexe Systeme und wie verhalten sie sich Was bedeutet das für die wissenschaftliche und rationale Betrachtung der Welt, vor allem auch für die Herausforderungen der Zukunft? Am Anfang steht die Frage: wie verhalten sich eigentlich die wichtigen Systeme, die unser Leben ermöglichen? »Die Natur macht keine Sprünge«, Carl von Linné Ist das so? Einfache mechanische und simple Systeme zeigen einfache Ursachen/Wirkungszusammenhänge – im Gegensatz zu komplexen Systemen: Wieso wird die Sahara nach langer Zeit mit stabilem Bewuchs in kurzer Zeit zu einer Wüste? Warum kollabieren Seen oder Korallenriffe Wie sieht es mit der Vorhersagekraft von technischen und sozialen Systemen aus? Wer hat den Fall der Berliner Mauer, Flash-Crashs an der Börse oder Donald Trump als Präsidenten korrekt vorhergesagt? ”In der großen Verkettung der Ursachen und Wirkungen darf kein Stoff, keine Thätigkeit, isoliert betrachtet werden.“, Alexander von Humboldt im 18. Jahrhundert Wir leben also nicht in einer Welt der simplen, sondern der wicked problems. Wie kommt das? Fragen wir konkreter nach Was ist ein System? Was sind Systemgrenzen? …und dann noch Skaleneffekte? Kompliziert oder komplex? Fassen wir einfach nochmals zusammen: was ist jetzt der Unterschied? Warum interessiert uns das alles? Heute und in der Zukunft? Wir kämpfen nicht nur mit dem drohenden Kollaps lebenswichtiger natürlicher Systeme, heute werden auch die »künstlichen«, die technischen und sozialen Systeme immer komplexer. So ist es extrem wichtig zu unterscheiden ob wir es mit komplexen Systemen, komplexen Problemen zu tun haben denn sie verhalten sich sehr unterschiedlich müssen mit unterschiedlichen Methoden untersucht werden Management, Kontrolle und Fehlersuche in solchen Systeme erfordert ebenfalls sehr unterschiedliche Strategien Was ist daher das größte Problem unserer Zeit? Das größte Problem ist es, wenn Menschen fragen, welches das größte Problem unserer Zeit ist. Denn fast alle Herausforderungen die unsere Zukunft bestimmen sind in komplexer Weise miteinander verbunden. Wir lösen sie also mehr oder weniger gemeinsam, oder gar nicht Und wie immer, sehen wir nach dieser Episode betroffen, den Vorhang zu und alle Fragen offen. Referenzen Rich Hickey: Simple made easy Donella Meadows, Thinking in Systems, Chelsea Green Publishing (2008) Warren Weaver, Science and Complexity, American Scientist, 36: 536 (1948) Andrea Wulf, Alexander Humboldt G. Cumming, Unifying Research on Social-Ecological Resilience and Collapse (2017) Chris Clearfield, Meltdown: Why our systems fail and what we can do about it Charles Perrow, Normale Katastrophen Rupert Riedl, Strukturen der Komplexität (2000) Nassim Taleb, Skin in the Game Peter Kruse, next practice. Erfolgreiches Management von Instabilität
-
Folge vom 12.08.2019009 - Abstraktion: Platos Idee, Kommunismus und die ZukunftEine nächste »Guerilla-Attacke« auf die Festung Wissenschaft, mit Blick in die Zukunft: Welche Rolle spielt Abstraktion für das moderne, wissenschaftliche Denken? (1) Wir beginnen mit der Frage, wie sich das Denken vom Speziellen zum Allgemeinen, oder vom »Mythos« zum »Logos« entwickelt hat, besuchen dazu das antike Griechenland, Plato, Aristoteles und die Pythagoräer. (2) Dann machen wir einen Zwischenstopp während der kommunistischen Revolution in Russland zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Entfernte Regionen der Sowjetunion wurden durch radikale soziale und ökonomische Änderungen gezwungen. Dazu gehört auch ein Bildungsprogramm, das die entferntesten russischen Regionen mit einschließt. Der russische Psychologe Alexander Luria begleitet diese Entwicklung und sieht dies als »natürliches Experiment«. Er fragt sich wenn man die Arbeit der Menschen verändert und ihnen mehr Abstraktion beibringt: welchen Einfluss wird das auf ihr Denken und ihren Geist haben? »Vormoderne Menschen sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht, moderne Menschen die Bäume nicht im Wald.« (3) Wir kehren dann in die Gegenwart um zu sehen, warum Abstraktion fundamental für einen erfolgreichen Umgang mit unserer Zukunft ist John Dewey: Über das Lösen von Problemen Flynn Effekt – und unser Lernen von der komplexen Umgebung in der wir uns bewegen Wie reagieren Schule und Universität? Und zuletzt stellt Franz Wuketits die These in den Raum, dass Abstraktion für unseren Umgang mit der Zukunft fundamental ist. Referenzen Griechenland David C. Lindberg, The Beginnings of Western Science, Univ. of Chicago Press (1992) Luciano de Crescenco, Geschichte der griechischen Philosophie, Diogenes (2016) Günter Küppers (Hrsg.), Chaos und Ordnung, Formen der Selbstorganisation in Natur und Gesellschaft, Reclam (1996) Die sozialistische Revolution und die soziologische Beobachtung David J. Epstein, Range, Penguin (2019) J. R. Flynn, The Mean IQ of Americans: Massive Gains 1932 to 1978, Psychological Bulletin 95, no. 1 (1984) Alexander Luria, Cognitive Development. Its Cultural and Social Foundations, Harvard University Press (1976) Lernen, Gesellschaft und Zukunft John Dewey, Theory of Inquiry (1938) Franz M. Wuketits, Animal irrationale. Eine kurze (Natur-)Geschichte der Unvernunft, edition unseld (2013) Weiteres Nassim Taleb, Fooled by Randomness, Penguin (2007) Alfred North Whitehead, The Education of an Englishman, The Atlantic Monthly, Vol. 138 (1926), p. 192.
