Um Mitternacht wird die Sektorengrenze abgeriegelt. Reporter berichten schon in den frühen Morgenstunden von den Bauarbeiten. Mit Betonpfählen und Stacheldraht beginnt der Bau der Berliner Mauer. Zu hören: Aufnahmen aus Ost und West. Gábor Paál im Gespräch mit Dr. Stefan Wolle, DDR-Museum Berlin. | Manuskript und mehr zur Sendung: http://swr.li/mauerbau | Bei Fragen und Anregungen schreibt uns: wissen@swr2.de | Folgt uns auf Twitter: @swr2wissen und @SWR2Archivradio
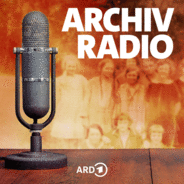
Kultur & Gesellschaft
Archivradio – Geschichte im Original Folgen
Historische Aufnahmen und Radioberichte von den ersten Tonaufzeichnungen bis (fast) heute. Das Archivradio der ARD macht Geschichte hör- und die Stimmung vergangener Jahrzehnte fühlbar. Präsentiert von: Gábor Paál, Lukas Meyer-Blankenburg, Maximilian Schönherr und Christoph König. Ein Podcast von SWR, BR, HR, MDR und WDR. https://archivradio.de | Übersicht über alle Beiträge: http://x.swr.de/s/archivradiokatalog
Folgen von Archivradio – Geschichte im Original
989 Folgen
-
Folge vom 11.08.2021Der Mauerbau 1961 – Eskalation im Kalten Krieg | Archivradio-Gespräch
-
Folge vom 06.08.2021Walter Ulbricht im Gespräch mit Arbeitern und Soldaten | 14.8.1961Am Tag nach Beginn des Mauerbaus begleitet das DDR-Fernsehen Walter Ulbricht, wie er sich in Ostberlin unters Volk mischt und mit Arbeitern und Soldaten spricht – vorbereitet durch eine überschwängliche Anmoderation.
-
Folge vom 06.08.2021Propagandamusik zum Mauerbau: "Unser schönes Berlin wird sauber sein" | 14.8.1961Zur DDR-Propaganda gehörte auch Musik. Einen Tag nach Abriegelung der Sektorengrenze in Berlin sendet Radio DDR am 14. August 1961 einige Lieder, die die Maßnahmen der Regierung als Befreiung und Säuberung Berlins glorifizieren. Den Anfang macht das folgende Stück des Komponisten Walter Kubiczeck. Der Text stammt von Eberhard Fensch. Laut der Ansage im Radio wurden dieses und andere Stücke angeblich innerhalb weniger Stunden geschrieben. Im Lied ist von den „Kalten Kriegern am Rhein“ die Rede. Dies spielt auf einen Vorwurf an, der in der DDR immer zu hören war, dass es in Bonn Pläne gäbe, die DDR zu annektieren, und schließlich die Grenzen von 1939 wieder herzustellen.
-
Folge vom 06.08.2021Willy Brandt verurteilt Mauerbau – Eine seiner emotionalsten Reden | 16.8.1961Am 13. August 1961 beginnt in Berlin der Bau der Mauer – nachdem der DDR-Staatsratsvorsitzende Walter Ulbricht am 15. Juni 1961 noch behauptet hatte, niemand habe die Absicht, eine Mauer zu errichten. Am 16. August findet vor dem Schöneberger Rathaus eine große Protestkundgebung statt. Dort spricht auch der Regierende Bürgermeister Willy Brandt. Es ist eine seiner entschiedensten und emotionalsten Reden. Er macht deutlich: Es geht hier um weit mehr als nur um Berlin. Man dürfe sich das nicht bieten lassen. Brandt warnt vor weiterer Appeasement-Politik. Denn die Versuche, durch politische Kompromisse und wirtschaftliche Abkommen der DDR-Führung entgegenzukommen, seien offenbar gescheitert und hätten diese nur noch zu weiteren Repressionen ermutigt. Und wer jetzt noch aus dem Westen zur Leipziger Buchmesse reise, solle gleich drübenbleiben.
