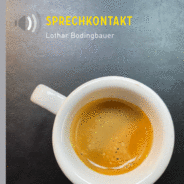Paludarien sind Uferlandschaften hinter Glas, mit Moosen, Farnen, Pflanzenerde und Wasserpflanzen. Sie zu gestalten, ist eine eigene Wissenschaft und Kunst. Für optimale Lebensbedingungen sind eine konstant hohe Luftfeuchtigkeit, die richtige Beleuchtung und eine ausgezeichnete Wasserqualität nötig. Vor allem in Japan hat die ästhetisch anspruchsvolle Auskleidung solcher Ökosysteme zwischen Land und Wasser eine große Tradition und gilt dort als meditative Tätigkeit. Aber auch hierzulande existiert eine lebendige Szene, in der wissenschaftliche Erkenntnisse ausgetauscht und auf Wettbewerben die schönsten Aquaterrarien auszeichnet werden. Sendung von Österreich 1 / Dimensionen vom 19.03.2025.
Folgen von Sprechkontakt
50 Folgen
-
Folge vom 23.04.2025PHS256 Sumpflandschaften hinter Glas
-
Folge vom 23.04.2025H047 WindmusikIn dieser Episode von Horch XYZ erkunden wir die Funktion von Luft und Klang. Gemeinsam mit Alexander Moosbrugger diskutieren wir den Einflusses des "Windes an den Rändern". Mit Klangbeispielen vom Intonieren der neuen Rieger-Orgel in Helsinki und dem Spiel des Winds in Elisabeths Blockflöten.
-
Folge vom 12.03.2025PHS255 Paludarien – auch aus Sicht der TiereZu Gast: Stefan Reithofer. In dieser Episode der Physikalischen Soiree, Nr. 255, diskutiere ich mit meinem Gast Stefan über die faszinierende Welt der Paludarien. Diese einzigartigen Systeme kombinieren Aspekte von Aquarien und Terrarien und ermöglichen es uns, eine vielfältige Umgebung zu schaffen, die sowohl Wasser als auch Land umfasst. Als Tierpfleger und Aquaristik-Enthusiast bringt Stefan wertvolle Expertise über die Tiere mit, die in diesen besonderen Lebensräumen gedeihen können. Wir beginnen mit einer detaillierten Erklärung, was ein Paludarium ausmacht. Stefan beschreibt es als Nachbildung eines Sumpfgebiets, das sowohl Wasser- als auch Landbereiche bietet. Dabei erforschen wir die verschiedenen Arten von Aquaterrarien, darunter Rivarium und Riparium, und unterhalten uns über die korrekte Terminologie, die oft in der Aquaristik verwendet wird. Außerdem werfen wir einen Blick auf Wabikusa, eine besondere Kunstform, die mit Wasserpflanzen arbeitet, die sowohl unter Wasser als auch über Wasser gedeihen. Ein zentrales Thema dieser Episode ist die Freude und Herausforderung, sich ein Paludarium zu Hause zu schaffen. Wir sprechen über die nötigen Überlegungen bei der Einrichtung, wie Licht, Temperatur und Feuchtigkeit, und die Geduld, die erforderlich ist, um ein funktionierendes und gesundes Ökosystem zu entwickeln. Stefan betont die Wichtigkeit der Vorbereitungen und der langfristigen Planung, um das Gleichgewicht im Paludarium zu wahren. Im Laufe unserer Unterhaltung beleuchten wir Einstellungen und Strategien zur Tierhaltung in Paludarien. Stefan erläutert, welche Tierarten, wie bestimmte Fische und Amphibien, sich in diesen Lebensräumen wohlfühlen und welche Bedingungen nötig sind, um diese Tiere artgerecht zu halten. Dabei gehe ich auf meine eigenen Erfahrungen ein und beschreibe die Biotope, die ich derzeit pflege, um den Zuhörern ein praktisches Verständnis für die Materie zu vermitteln. Ein weiterer interessanter Aspekt sind die symbiotischen Beziehungen zwischen den verschiedenen Lebensformen im Paludarium. Dies umfasst die Interaktionen zwischen Fischen und Pflanzen sowie zwischen Tieren, die in diesen komplexen Mini-Ökosystemen leben. Unsere Gespräche fördern ein tieferes Verständnis für die Herausforderungen und Freuden, die mit dem Betrieb eines Paludariums verbunden sind. Die Episode schließt mit dem Gedanken, dass Natur, egal in welchem Maßstab, eine dynamische Plattform für Beobachtungen und Lernprozesse bietet. Stefan unterstreicht die Bedeutung der Geduld und des kontinuierlichen Lernens, wenn man mit lebenden Systemen arbeitet. Seine abschließenden Worte ermutigen dazu, die Natur zu schätzen und die Schönheit und Komplexität der Ökosysteme zu erkennen, die wir zu uns nach Hause bringen können.
-
Folge vom 03.03.2025PHS254 Paludarium: Grenze zwischen Land und WasserIm Interview spricht Lothar mit Ingeborg Lang, einer Biologin am Department für Funktionelle und Evolutionäre Ökologie der Universität Wien, über ihre Forschung an Pflanzenzellen, insbesondere über Moose. Ingeborg erklärt, dass ihre Studien im Bereich der Ökologie und Zellbiologie angesiedelt sind, mit einem speziellen Interesse daran, wie Pflanzenzellen unter unterschiedlichen Feuchtigkeitsbedingungen reagieren. Sie diskutiert die physikalischen Veränderungen, die in Zellen und Blättern auftreten, wenn Pflanzen austrocknen oder ausreichend Wasser haben. Moose werden als faszinierende Forschungsobjekte hervorgehoben, da sie eine einfache Struktur aufweisen und sich leicht mikroskopieren lassen. Ingeborg hebt hervor, dass Moose die ersten Pflanzen sind, die den Übergang vom Wasser an Land vollzogen haben, was sie zu einem wichtigen Element der Evolution macht. Sie erläutert zudem, wie Moose in verschiedenen Lebensräumen wachsen können, von extrem sonnigen Standorten bis hin zu schattigen Bereichen, und dass sie sogar überleben können, wenn sie austrocknen, indem sie ihre Zellen anpassen und wieder wachsen, sobald sie wieder feucht sind. Die Konversation bewegt sich weiter auf die Anwendbarkeit von Moosen als bioindikatorische Organismen, die helfen können, metallische Kontamination in der Umwelt zu überwachen. Ingeborg beschreibt die Möglichkeiten, wie Moose Schwermetalle aus der Atmosphäre aufnehmen und speichern, was ihnen eine wichtige Rolle als Biomonitore verleiht. Sie führt aus, dass diese Fähigkeit von Bedeutung ist, um Umwelteinflüsse zu verstehen und Maßnahmen gegen Kontaminationen zu ergreifen. Das Thema Paludarien, die Kombination aus Wasser- und Landlebensräumen, wird weiter vertieft. Lothar erklärt sein persönliches Interesse an einem Paludarium, das er eingerichtet hat, und fragt Ingeborg nach den Herausforderungen und Möglichkeiten bei der Pflege dieser Ökosysteme. Ingeborg betont die Bedeutung von Feuchtigkeit und Licht für das Gedeihen der Pflanzen in einem Paludarium und diskutiert die physiologischen Anforderungen von Moose und anderen Pflanzen, die in solchen Bedingungen gedeihen müssen. Ein zentraler Punkt des Interviews ist die Diskussion über die Komplexität von Pflanzenzellen und ihren Anpassungen an verschiedene Umwelteinflüsse. Lothar und Ingeborg sprechen über die mechanischen und physikalischen Eigenschaften von Pflanzenzellen und deren Reaktionen auf Stressfaktoren wie Trockenheit und Überfeuchtung. Es wird erörtert, wie sich der Metabolismus von Pflanzenzellen unter verschiedenen Bedingungen verhält und welche Techniken in der Forschung angewendet werden, um diese Prozesse zu analysieren. Im weiteren Verlauf wird die Evolution von Pflanzen thematisiert, insbesondere die Entwicklung von mehrzelligen Organismen aus einzelligen Vorfahren und die Rolle von Wasser und anderen Ressourcen bei diesem Übergang. Ingeborg bringt ein, dass viele Pflanzen auch Strategien entwickelt haben, um in feuchten und trockenen Umgebungen zu überleben, und spricht über die Vitalkraft von Moosen, die in vielen Lebensräumen als Pionierpflanzen fungieren. Das Gespräch schließt mit Überlegungen zur Weitergabe von Wissen und den Unterschieden zwischen akademischer Forschung und Hobbyisten, die sich mit Botanik und Aquaristik beschäftigen. Ingeborg drückt ihre Wertschätzung für die Community von Hobbyisten aus, die oft tiefgehende Kenntnisse über bestimmte Pflanzenarten besitzen. Sie betont, dass der Austausch von Wissen zwischen Wissenschaft und praktischer Anwendung wichtig ist, um das Verständnis von Pflanzen und Ökosystemen zu vertiefen. Insgesamt bietet das Interview einen tiefen Einblick in die für das Überleben von Pflanzen entscheidenden Faktoren, die Evolution der Flora und die komplexen Wechselwirkungen zwischen Pflanzen, ihrer Umwelt und den Forschungsmethoden, die verwendet werden, um dieses faszinierende Gebiet weiter zu erforschen.