Am 20. März 2003 greifen die USA unter Präsident George W. Bush den Irak an. Großbritannien wird sich kurz darauf anschließen. Die offiziellen Begründungen lauten: Der Irak unterstütze den internationalen Terrorismus und das Terrornetzwerk al-Qaida. Und der Irak habe Massenvernichtungswaffen. Beides hielten die meisten unabhängigen Fachleute damals schon für falsch, was sich später auch bestätigen sollte. Die Bundesregierung lehnte den Krieg zusammen mit Frankreich und Russland ab. Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) hatte damit im vorangegangenen Bundestagswahlkampf auch Punkte in der Bevölkerung gemacht. Das Verhältnis zum US-Präsidenten hatte darunter ziemlich gelitten, doch die USA hat es nicht vom Krieg abgehalten. In vielen Radiosendern laufen an jenem Tag Sondersendungen mit Berichten aus aller Welt. Wir hören Berichte über die Reden von US-Präsident Bush, von Iraks Diktator Saddam Hussein und US-Verteidungsminister Donald Rumsfeld. Und wir hören die kritische Stellungnahme von Bundeskanzler Gerhard Schröder und noch kritischere Reaktionen aus der deutschen Bevölkerung. Doch los geht es mit einem ersten Live-Gespräch um 4:30 Uhr mit ARD-Reporter Stephan Kloss, der die Situation in der Hauptstadt Bagdad schildert.
Bitte melde dich an oder registriere dich, um fortfahren zu können.
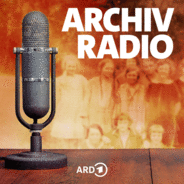
Kultur & Gesellschaft
Archivradio – Geschichte im Original Folgen
Historische Aufnahmen und Radioberichte von den ersten Tonaufzeichnungen bis (fast) heute. Das Archivradio der ARD macht Geschichte hör- und die Stimmung vergangener Jahrzehnte fühlbar. Präsentiert von: Gábor Paál, Lukas Meyer-Blankenburg, Maximilian Schönherr und Christoph König. Ein Podcast von SWR, BR, HR, MDR und WDR. https://archivradio.de | Übersicht über alle Beiträge: http://x.swr.de/s/archivradiokatalog
Folgen von Archivradio – Geschichte im Original
988 Folgen
-
Folge vom 19.03.2023Beginn des Irak-Kriegs | 20.3.2003
-
Folge vom 10.03.2023Bayern-Trainer Giovanni Trapattoni platzt der Kragen: "Ich habe fertig!" | 10.3.1998Juventus Turin, Inter Mailand, FC Bayern München – Giovanni Trapattoni hat in seiner Karriere viele Spitzenvereine trainiert. In Erinnerung geblieben ist er jedoch vor allem wegen eines Ausrasters am 10. März 1998, dessen Sätze immer wieder gerne zitiert werden: "Spieler schwach wie eine Flasche leer." – "Was erlaube Strunz!" – "Ich habe fertig!". Vorausgegangen war eine 0:1-Niederlage der Bayern gegen Schalke 04.
-
Folge vom 09.03.2023Frieden mit Russland: Ansprache im Preußischen Abgeordnetenhaus | 3./8.3.1918Am 3. März 1918 kommt es zum Friedensschluss mit Russland. Der Präsident des Preußischen Abgeordnetenhauses Hans von Schwerin-Löwitz erklärt, man könne sich nun auf die Westfront konzentrieren. Er spricht vom „Endsieg“ und verliest ein Glückwunschtelegramm an den Kaiser. Die Nachaufnahme der Rede stammt vom 8. März 1918. | Viele weitere Audios aus dem Ersten Weltkrieg: http://swr.li/erster-weltkrieg
-
Folge vom 06.03.2023Pressekonferenz: Peter Lorenz ist frei | 5.3.1975 | RAFWenige Stunden nach seiner Freilassung tritt CDU-Spitzenpolitiker Peter Lorenz in Berlin vor die applaudierende Weltpresse.
