Der Bundestag hat das „Wehrdienst-Modernisierungsgesetz“ beschlossen. Alle 18-jährigen Männer und Frauen erhalten ab Anfang 2026 einen Fragebogen, mit dem ihre Motivation und Eignung für den Dienst bei der Bundeswehr ermittelt werden soll. Für alle Männer, die nach dem 1. Januar 2008 geboren wurden, ist die Beantwortung des Fragebogens und eine Musterung verpflichtend, für Frauen freiwillig. Sollte die Zahl derjenigen, die sich freiwillig zum Wehrdienst melden, den Bedarf der Bundeswehr allerdings nicht decken, kann der Bundestag eine sogenannte „Bedarfswehrpflicht“ ausschließlich für Männer beschließen. Die, die es nicht persönlich betrifft, stimmen dem neuen Gesetz überwiegend zu. Die, die es betreffen könnte, diskutieren seit Monaten heftig. Bereits im Frühjahr hat der 27-jährige Podcaster, Journalist und Autor Ole Nymoen mit seinem Buch „Warum ich niemals für mein Land kämpfen würde“ ein streitbares Plädoyer „Gegen die Kriegstüchtigkeit“ (Untertitel) veröffentlicht. Doris Maull hat Ole Nymoen kürzlich zum Gespräch getroffen.
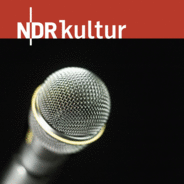
Kultur & GesellschaftTalk
NDR Kultur - Das Gespräch Folgen
Bei "Das Gespräch" kommen Menschen zu Wort, die Stellung beziehen und Positionen vertreten: kulturell oder gesellschaftlich, kenntnisreich, vielfältig und nicht selten provokant. Mal sind sie prominent und in aller Munde, mal ausgewiesene Experten auf ihrem Gebiet. Gemein ist ihnen allen, dass sie Inspirierendes zu sagen haben zu den Themen unserer Zeit - und oft auch sehr Persönliches. Wir stellen drängende Fragen und rollen nicht einfach den roten Teppich aus.
Folgen von NDR Kultur - Das Gespräch
75 Folgen
-
Folge vom 07.12.2025Gegen die Kriegstüchtigkeit - Ole Nymoen im Gespräch
-
Folge vom 30.11.2025Shoko Kuroe: Starke Stimme gegen Machtmissbrauch"Das war ein sexueller Übergriff, was man in der Alltagssprache wahrscheinlich Vergewaltigung nennen würde“, sagt die Pianistin Shoko Kuroe im Gespräch mit NDR Kultur. Und der Verantwortliche war ein Professor von Shoko Kuroe, er hat während der 90er Jahre an der Hamburger Musikhochschule unterrichtet. Die junge Frau, damals Mitte zwanzig, konnte zunächst nicht über das Verbrechen sprechen. „Ich hatte das komplett verdrängt, damit ich die seelische Stabilität behalten konnte.“, bekennt Kuroe – die in den vergangenen Jahren zu einer der wichtigsten Stimmen im Kampf gegen Machtmissbrauch geworden ist. Nachdem ihr Anliegen lange Zeit kaum Gehör gefunden hat, hat sich der öffentliche Umgang mit dem Thema mittlerweile stark verändert. Im Gespräch mit Marcus Stäbler betont Shoko Kuroe jedoch, dass es trotz der vielen Initiativen, der Beratungsangebote und der Sensibilität gegenüber Machtmissbrauch noch immer blinde Flecken gebe. Auch bei einer aktuellen Studie zum Thema, die jetzt an den deutschen Hochschulen durchgeführt werden soll. Das Problem sei, dass dort nur die derzeit Angehörigen der Hochschulen gehört werden. „Die Menschen, die dort irgendwas erfahren haben und dann aufgrund dessen von der Hochschule weggegangen sind oder gar keine Musik mehr machen oder die Hochschule gewechselt haben - die kommen nicht zur Sprache.“
-
Folge vom 23.11.2025John Irving über seinen neuen Roman "Königin Esther"Vom jüdischen Waisenkind zur zionistischen Freiheitskämpferin - mit bekanntem Irving-Personal. Der mittlerweile in Kanada lebende Schriftsteller John Irving zählt zu den großen US-amerikanischen Erzählern unserer Zeit. Viele seiner Romane, besonders "Gottes Werk und Teufels Beitrag", wurden internationale Bestseller. "Gottes Werk und Teufels Beitrag" ist die Geschichte von Homer Wells, der im Waisenhaus St. Cloud groß wird und von dessen Leiter Dr. Larch zu einem sensiblen, empathischen jungen Mann erzogen wird. Ein wichtiges Thema in diesem Buch ist das Recht auf Abtreibung, für das sich Dr. Larch intensiv einsetzt. Nun erscheint der neue Roman von John Irving. In "Königin Esther" wird die Lebensgeschichte einer jüdischen Waisin erzählt, deren Mutter von Antisemiten ermordet wurde und die von Amerika nach Palästina auswandert. In dem Buch gibt es auch ein Wiedersehen mit Dr. Larch und St. Cloud.
-
Folge vom 16.11.2025Nur Liebe kann uns noch retten: Autor Daniel Schreiber im GesprächDie „Baseballschläger-Jahre“ sind zurück, sagt Daniel Schreiber und meint damit die hasserfüllte Stimmung unserer Gegenwart – zwischen Klimawandel, Kriegen, Populismus und zerfallenden Demokratien. In seinem neuen Essay „Liebe. Ein Aufruf“ analysiert der Autor die Krisen unserer Zeit. Schreiber ist überzeugt: Wir sollten uns auf die politische Kraft der Liebe rückbesinnen – im privaten und öffentlichen Leben, in unserem politischen Miteinander, in unserem Verhältnis zur Welt. Im Gespräch mit Juliane Bergmann erläutert Daniel Schreiber, wie dieses Handeln mit Liebe konkret aussehen kann, wie man Feinden der Demokratie mit Liebe begegnet und wie man Menschen davon überzeugt, sich auf das Wagnis der gesamtgesellschaftlichen Liebe einzulassen.
