"Wilde Sehnsucht" ließ Ulf Werner vor Jahren aus dem Evangelischen Stift zu Tübingen auf den Kiez nach St. Pauli fliehen, um dort Punkrock zu machen. Hamburg sollte sein "Lehrmeister werden auf der Suche nach den heiligen Gottesmomenten, für die es sich zu leben lohnte." Jetzt spricht er mit seinem Buch "Wilde Sehnsucht. Punk, Predigt und Passion" einen Toast aus "auf Gottes Tresenpersonal - sie sind die Seelsorger, die Engel des Alltags, die jede Nacht bereitstehen für all diejenigen, die auf der Suche sind. Ich durfte von ihnen all die Dinge lernen, die nicht in den Lehrbüchern der Universitäten zu finden sind." Was ihn Hamburg und das (Nacht)Leben lehrte, wie er vom Rockpalast in die Kirche der Stille fand, warum Gottesmomente nicht auf Dauer gestellt werden können und warum alle Wege richtig sind, solange sie nur zu Gott führen - darüber denkt Ulf Werner im Gespräch mit Jürgen Deppe nach und kommt zu dem Schluss: "Gott steckt in allen Dingen."
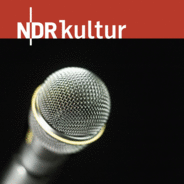
Kultur & GesellschaftTalk
NDR Kultur - Das Gespräch Folgen
Bei "Das Gespräch" kommen Menschen zu Wort, die Stellung beziehen und Positionen vertreten: kulturell oder gesellschaftlich, kenntnisreich, vielfältig und nicht selten provokant. Mal sind sie prominent und in aller Munde, mal ausgewiesene Experten auf ihrem Gebiet. Gemein ist ihnen allen, dass sie Inspirierendes zu sagen haben zu den Themen unserer Zeit - und oft auch sehr Persönliches. Wir stellen drängende Fragen und rollen nicht einfach den roten Teppich aus.
Folgen von NDR Kultur - Das Gespräch
66 Folgen
-
Folge vom 08.06.2025Punk-Pastor Ulf Werner: "Wir sind Sünder und Heilige zugleich"
-
Folge vom 01.06.2025Thomas und Heinrich Mann: "Man muss es als Bruderwerk sehen"Beim Schreiben seines Buches über die Lübecker Senatorensöhne sei ihm bewusst geworden, dass man weder das Werk von Thomas noch das Werk von Heinrich Mann allein in den Blick nehmen könne. "Man muss es als Bruderwerk sehen", betont Hans Wißkirchen, früher Leiter des Buddenbrookhauses in Lübeck und heute Präsident der Thomas Mann-Gesellschaft. "Isolation ist da nicht der richtige Weg." Mit seinem aktuellen Buch "Zeit der Magier - Heinrich und Thomas Mann 1871-1955" habe er die beiden Brüder miteinander in einen Dialog bringen wollen. Im Gespräch mit Linda Ebener erzählt Hans Wißkirchen, wie es zu dem Buch gekommen ist, was ihn während des Schreibens überrascht hat und warum die beiden gebürtigen Lübecker nie wieder in ihre Heimatstadt zurückgekehrt sind.
-
Folge vom 25.05.2025Diversitäts-Agentin Leyla Ercan: Bedrohte Vielfalt nicht nur in der NaturUnd genau das hat sich Leyla Ercan zur Aufgabe gemacht. Die überzeugte Hannoveranerin war "Diversitäts-Agentin" am Staatstheater der niedersächsischen Hauptstadt. Heute trägt sie ihre Erfahrungen und ihr Wissen über die Vielfalt von ethnischer und sozialer Herkunft, von religiöser und geschlechtlicher Orientierung, von Möglichkeiten und Handicaps als Referentin, Lehrbeauftragte und Kulturberaterin in Unternehmen, Hörsäle und die Öffentlichkeit. Kurz vor dem diesjährigen Deutschen Diversity Day am 27. Mai hat Alexandra Friedrich mit Leyla Ercan darüber gesprochen, warum Diversität essenziell ist, und warum sie nicht von selbst "passiert", sondern Engagement erfordert. Sie verrät, wie divers und offen die Theaterwelt tatsächlich ist, und ob das, was im Künstlerischen behauptet wird, auch hinter den Kulissen Realität ist.
-
Folge vom 18.05.2025Axel Bojanowski: "Die Welt ist besser, als wir denken"Mit seinen Büchern erreicht Axel Bojanowski regelmäßig eine große Leserschaft. "Was sie schon immer übers Klima wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten" wurde zum Spiegel-Bestseller. Wohl auch, da der Welt-Journalist einen Hang zu steilen Thesen hat, die von vielen nicht unwidersprochen bleiben. So findet er die Berichterstattung über den Klimawandel einseitig, die Debatten darüber von einer grünen Lobby gesteuert und Atomkraftwerke grundsätzlich prima. In seinem neuesten Buch geht der Geowissenschaftler auf positive Entwicklungen ein, die nach seinem Geschmack zu wenig Beachtung finden. "33 erstaunliche Lichtblicke, warum die Welt besser ist als wir denken" ist gerade im Westend-Verlag erschienen. Im Gespräch beweisen Axel Bojanowski und Martina Kothe, dass man über kontroverse Themen freundlich und gepflegt diskutieren kann.
