«Schönes gehört auch zur Realität.» Davon war Lotte Ravicini Tschumi überzeugt. Sie liebte Liebesromane. 3000 Bücher aus der Zeit von 1850–1950 hat sie zusammengetragen. Die kleine Bibliothek in Solothurn zieht auch Menschen aus der Wissenschaft an. Denn Liebesromane sind auch Spiegel ihre Zeit.
· Romantisch: Lotte Ravicini Tschumi liebte gefühlvolle Romane
· Emanzipiert: Als Modejournalistin führte Lotte Ravicini Tschumi ein sehr eigenständiges Leben
· Sammellust: In der Solothurner Altstadt richtete sie ein Kabinett für sentimentale Trivialliteratur ein
· Populär: Warum Trivialliteratur lange Zeit nicht ernst genommen wurde
· Realitätsnah: Was Liebesromane über ihre Zeit erzählen
· Aktuell: Mit New Romance feiert der Liebesroman ein Comeback
Im Podcast zu hören sind: Aufzählung
· Lotte Ravicini Tschumi (1930-2021), Gründerin des Kabinetts für sentimentale Trivialliteratur (Archivaufnahmen)
· Peter Probst, Präsident der Stiftung des Kabinetts für sentimentale Trivialliteratur
· Christine Lötscher, Professorin für populäre Literatur und Medien an der Universität Zürich
Erstsendung: 2.5.2025
Bei Fragen, Anregungen oder Themenvorschlägen schreibt uns: kontext@srf.ch
Autorin: Alice Henkes
Host: Katrin Becker
Produktion: Anna Jungen
Technik: Michael Studer
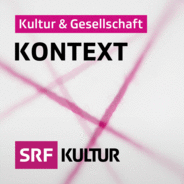
Politik
Kontext Folgen
Neu finden Sie die aktuellsten und relevantesten Themen aus Kultur und Gesellschaft in unserem Format «Kulturplatz Talk». Hier kommen täglich Stimmen aus Literatur, Musik, Kunst und Gesellschaft zu Wort. Persönlich, pointiert und nah an der Gegenwart - Montag bis Freitag auf Radio SRF 2 Kultur.
Folgen von Kontext
50 Folgen
-
Folge vom 01.08.2025Herzschmerz und Frauenpower: Das Kabinett für Trivialliteratur(W)
-
Folge vom 31.07.2025Kultur-Talk: Ernst Jandl zum HundertstenAm 1. August würde Ernst Jandl 100 Jahre alt. Und auch, wenn er schon seit 20 Jahren nicht mehr lebt, seine Gedichte sind unvergessen. «schzngrrm», «ottos mops», wien; heldenplatz», «fünfter sein» – sie alle gehören zum Kanon der deutschsprachigen Lyrik und leben im Gedächtnis der Menschen weiter. Einer, der ganz nah an Ernst Jandl dran gewesen ist, ist der Lektor und Herausgeber Klaus Siblewski. 20 Jahre lang hat er ihn als Lektor begleitet. Ganze drei Werk-, respektive Gesamtausgaben hat er mit Jandls Werk herausgebracht. Im Gespräch mit Michael Luisier erzählt er von Jandls Bedeutung als Dichter und Dramatiker, gibt Einblick in Jandls Arbeitsweise und Absichten und erzählt von Jandls langem Kampf um Akzeptanz. Ein seltener Einblick in Wesen und Werk eines einzigartigen Sprachkünstlers und grossen Dichters. Buchempfehlung: Ernst Jandl. Werke in sechs Bänden. 3712 Seiten. Luchterhand, 2016.
-
Folge vom 30.07.2025Kultur-Talk: Zuhören (W)Warum bloss hört niemand zu? Der renommierte Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen erklärt, welche Mechanismen das Zuhören verhindern – ob im privaten Umgang oder in der Öffentlichkeit. «Zuhören», «Gehörtwerden», «einen Dialog auf Augenhöhe führen» – das sind Schlagworte unserer Zeit, aber leider meist nur leere Floskeln. Was heisst es, wirklich zuzuhören? Die eigenen Überzeugungen in Frage zu stellen und sich der Weltsicht eines anderen auszusetzen? Diesen Themen widmet sich der deutsche Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen in seinem neuen Buch «Zuhören». Er propagiert das Zuhören als eine Geisteshaltung, als eine neue Offenheit gegenüber der Welt, als innere Gastfreundschaft. Inmitten medialer Dauerbeschallung von allen Seiten wünscht er sich eine neue Kultur der Nachdenklichkeit. Gretchenfrage: Wie lässt sich diese etablieren? Buchangaben: Bernhard Pörksen: «Zuhören. Die Kunst, sich der Welt zu öffnen». 336 Seiten. Hanser, 2025. Erstsendung: 12.2.2025
-
Folge vom 29.07.2025Kultur-Talk: Die Medien und die Künstliche Intelligenz (W)Künstliche Intelligenz ist längst im Alltag angekommen, etwa wenn wir einen Begriff in eine Suchmaschine eingeben. Was bedeutet nun die Lern-Fähigkeit von Maschinen für die Medien? Wie setzen sie heute Künstliche Intelligenz ein? Welche Gefahren und Möglichkeiten bietet KI im redaktionellen Alltag? Die Medienhäuser machen sich Gedanken, wie sich KI in den Redaktionen berufsethisch unbedenklich einsetzen lässt: als Hilfsmittel. Doch Kontrolle und Verantwortung sollen immer den Menschen obliegen. Was kann KI? Was kann sie nicht? Was bedeutet KI für die Medien-Nutzerinnen und -Nutzer? Es diskutieren die Informatikerin Sabine Süsstrunk, Professorin an der Fakultät für Informatik und Kommunikationswissenschaften an der EPFL in Lausanne und Verwaltungsrätin der SRG, und Alexandra Stark, die unter anderem CH Media in Sachen KI berät und der Eidgenössischen Medienkommission angehört. Erstsendung: 14.2.2025
