Krisenzeiten sind gute Zeiten für neue und nachhaltige Produkte, das hat der Serienunternehmer Phil Libin in seiner Laufbahn immer wieder beobachtet: „Wenn die Wirtschaft sehr stark ist, ist es eine gute Zeit, Dinge zu verkaufen“, sagt der ehemalige Chef des Onlinedienstes „Evernote“ im Podcast Handelsblatt Disrupt. „Wenn die Wirtschaft schwächelt, ist es eine gute Zeit, Dinge zu bauen.“ Diese Phasen seien gut, „um sich hinzusetzen, sich zu konzentrieren und zu fokussieren“.
In der Coronakrise hat der US-Unternehmer auch seine Führungsprinzipien überdacht. Und er ist dabei vom Homeoffice-Gegner zum Verfechter der neuen Work-from-home-Kultur geworden: „Ich werde niemals von einem Programmierer, einem Designer oder einem Anwalt verlangen, drei Stunden am Tag im Stau zu stehen“, sagt Libin. „Das ist schrecklich und unmenschlich.“
Im Hinblick auf die Kommunikation im Team plädiert er für ein dreistufiges Verfahren. Geht es um den reinen Wissensaustausch, genügen aufgezeichnete Informationsvideos. Sind Teilnehmer aufgefordert, miteinander zu diskutieren, schlägt er interaktive Videokonferenzen vor. Geht es um Erfahrungen mit Kollegen, sei physischer Kontakt nötig. In seinem Unternehmen kommt das aber wohl nicht allzu häufig vor: Er selbst hat seine Wohnung in San Francisco aufgelöst und ist nach Arkansas gezogen - allen Mitarbeitern hat er gesagt, dass er nie wieder eine Büropflicht einführen wird.
Heute leitet Libin mit „All Turtles“ ein Studio für Künstliche Intelligenz, das zahlreiche Projekte unterstützt: von „Tasseled“, das Schülern bei der Planung eines möglichst kostengünstigen Studiums hilft, bis zu „Carrot“, das Arbeitgebern ermöglicht, ihre Mitarbeiter bei Fruchtbarkeitsbehandlungen zu unterstützen. Hinter dieser Firma steht auch Kritik am Silicon Valley: Libin kritisiert, dass von jedem Vordenker mit einer guten Idee erwartet werde, ein Start-up zu gründen, auch wenn er dazu nicht genügend unternehmerische Fähigkeiten besitze. Mit „All Turtles“ will Libin diesen Vordenkern helfen, ihre Ideen umzusetzen, ohne dafür eine Firma gründen zu müssen.
***
Das exklusive Abo-Angebot für Sie als Handelsblatt Disrupt-Hörerinnen und Hörer: https://www.handelsblatt.com/mehrwirtschaft
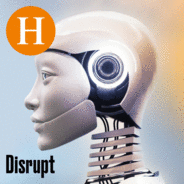
Wissenschaft & Technik
Handelsblatt Disrupt - Der Podcast über die Zukunft der Wirtschaft Folgen
Handelsblatt Disrupt - Der Podcast über die Zukunft der Wirtschaft mit 1 bewerten
Handelsblatt Disrupt - Der Podcast über die Zukunft der Wirtschaft mit 2 bewerten
Handelsblatt Disrupt - Der Podcast über die Zukunft der Wirtschaft mit 3 bewerten
Handelsblatt Disrupt - Der Podcast über die Zukunft der Wirtschaft mit 4 bewerten
Handelsblatt Disrupt - Der Podcast über die Zukunft der Wirtschaft mit 5 bewerten
Im Podcast Handelsblatt Disrupt diskutiert Chefredakteur Sebastian Matthes jeden Freitag mit CEOs, Unternehmerinnen, Politikern, Investorinnen und Innovatoren über die großen Veränderungen in der Wirtschaft. Handelsblatt Disrupt finden Sie auf allen relevanten Podcast-Plattformen - und natürlich hier auf der Handelsblatt-Website. Jetzt reinhören: Jeden Freitag mit Handelsblatt Chefredakteur Sebastian Matthes. Logo-Design: Henrik Balzer, Michel Becker
Folgen von Handelsblatt Disrupt - Der Podcast über die Zukunft der Wirtschaft
332 Folgen
-
Folge vom 15.07.2022Ex-Evernote-CEO Libin: „Abschwünge sind eine sehr gute Zeit, um Dinge von Wert zu bauen“
-
Folge vom 08.07.2022Ex-Tesla-Ingenieur Berdichevsky über die Batteriezelle der ZukunftGene Berdichevsky, Co-Gründer des Tech-Start-ups Sila Nanotechnologies, will Batterien aus Silizium in Serienfertigung bringen. Im Podcast Handelsblatt Disrupt erklärt er, wie das geht – und wie Batteriezellen von Elektroautos künftig schneller laden und mehr Energie speichern können. „Insgesamt sehen wir bis zum Ende des Jahrzehnts eine Verbesserung der Energiedichte um etwa das Doppelte gegenüber dem bisherigen Stand der Technik“, sagt Berdichevsky. Er prognostiziert, dass die Kosten „durch diese Innovationen bis zum Ende des Jahrzehnts von etwa 100 Dollar pro Kilowattstunde auf etwa 50 Dollar sinken könnten“. Silizium in der Anode der Batterien einzusetzen, ist nicht neu. Die Verarbeitung ist wegen bestimmter physikalischer Eigenschaften jedoch nicht leicht. Die Ursache: Das Halbmetall dehne sich beim Aufladen der Batterie stark aus, sagt Berdichevsky. „Das ist wirklich schädlich für die Batterie.“ Also entwickelte Sila Nanotechnologies eine neue Technik, die der Belastung standhält. Schon heute wird die Technik in Fitnesstrackern verbaut. Der nächste Partner von Sila ist die Autoindustrie. Weil die Verarbeitung so kompliziert ist, setzen große Autohersteller wie Mercedes und BMW auf spezialisierte Start-ups wie Sila. „Wir versuchen ihnen dabei zu helfen, ein besseres Fahrzeug zu bauen“, sagt Berdichevsky. Mit Erfolg: In der elektrischen Mercedes-Benz-G-Klasse wird die neue Generation verbaut. Berdichevsky war der siebte Angestellte des Elektroautobauers Tesla und leitete die Entwicklung eines der weltweit ersten Lithium-Ionen-Batteriesystems für Kraftfahrzeuge, das in Serie produziert wurde. Er ist Absolvent der renommierten Stanford-Universität, Inhaber zahlreicher Patente und wurde 2013 in die Forbes-Liste 30 und 30 aufgenommen. *** Das exklusive Abo-Angebot für Sie als Handelsblatt Disrupt-Hörerinnen und Hörer: handelsblatt.com/sommer-special
-
Folge vom 01.07.2022Ifo-Chef Clemens Fuest über den wahren Zustand der deutschen WirtschaftSteigende Inflation, Krieg in der Ukraine, Fachkräftemangel – Clemens Fuest, Chef des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, und Chefredakteur Sebastian Matthes sprechen im Podcast Handelsblatt Disrupt über die großen Krisen der Gegenwart. Fuest schlägt vor, diese „mehr von hinten zu denken“. Was er damit meint, erklärt er anhand mehrerer Beispiele, etwa der drohenden Eurokrise. Wenn Europa die Währungsunion bewahren wolle, müsse die Europäische Zentralbank (EZB) ihrem „klaren Auftrag“ nachkommen, „für Preisstabilität zu sorgen“, sagt er. „Das bedeute, sie muss aufhören, mehr Staatsanleihen zu kaufen, und sie muss die Zinsen erhöhen.“ Durch die Konjunkturprognosen des Ifo-Instituts kennt Fuest die Stimmung in der Wirtschaft gut. Das Geschäftsklima, sagt er, sei stabil geblieben – aber die Entwicklung in den nächsten sechs Monaten schätzten die befragten Unternehmen negativ ein. „Die Unternehmen machen sich erhebliche Sorgen.“ Im Podcast erklärt er die Ursachen. Matthes und Fuest diskutieren außerdem über das Krisenmanagement der Bundesregierung und über die Frage, weshalb sich die Politik auf kurzfristige Maßnahmen fokussiert, statt in langfristigen Strategien zu denken. Der Fachkräftemangel beschäftigt den Ökonomen besonders. Bestand früher die Sorge, dass Automatisierung Jobs kostet, kommt sie heute nicht schnell genug voran, um die Arbeit zu übernehmen, die Menschen nicht leisten können. „Wir haben gleichzeitig Angst davor, zu wenig Arbeitskräfte zu haben und zu wenig Arbeitskräfte zu brauchen“, sagt er. „Nur eins kann richtig sein.“ *** Das exklusive Abo-Angebot für Sie als Handelsblatt Disrupt-Hörerinnen und Hörer: https://www.handelsblatt.com/mehrwirtschaft
-
Folge vom 24.06.2022Investorin Gfrerer: Das Ende von „Wachstum um jeden Preis“Der Start-up-Boom von 2021 sieht aus wie eine Blase. In der Krise mit Krieg und Inflation zeigt sich, dass viele Geschäftsmodelle nicht tragfähig sind: „Wir standen lange in der Flut und jetzt kommt die Ebbe und dann sehen wir, wer hat wirklich die Badehose an“, sagt Investorin Eva-Valérie Gfrerer im Podcast Handelsblatt Disrupt. Hat im vergangenen Jahr noch fast jede Firma Geld bekommen, halten Investoren plötzlich ihr Geld zusammen. Hochbewerteten Firmen droht das Geld auszugehen. In den vergangenen Jahren hätten Investoren auf „Wachstum um jeden Preis“ gesetzt, sagt Gfrerer. Auf Unternehmensseite habe das dazu geführt, dass Firmen „sehr viel Kapital in Marketingaktionen gepusht haben, um neue Kunden einzukaufen“. Im Gespräch mit Tech-Reporterin Larissa Holzki prognostiziert sie, dass die ersten Entlassungen bei Berliner Start-ups erst den Anfang einer Krise markieren. Sie sieht aber auch Chancen für ein Umdenken und einen stärkeren Fokus auf nachhaltige Geschäftsmodelle. Ihr Appell an die eigene Zunft: „Die Art und Weise, wie heute investiert wird, muss verändert werden“, fordert sie. 2019 hat Eva-Valérie Gfrerer ihre Investmentfirma Morphais gegründet, die Künstliche Intelligenz im Investmentprozess einsetzt. Damit findet sie Gründer, die bei anderen Risikokapitalgebern durch's Raster fallen: „Wir sehen, dass wir so viel effizienter sein können, so viel skalierbarer investieren können und das Risiko so viel besser managen können, wenn wir Technologie dafür verwenden.“ Sie verweist auf Studien, die zeigen: Mit datenbasierten Investments ließe sich im Schnitt sechzehnmal so viel Geld erwirtschaften wie in einen Fonds eingezahlt wurde. Ein traditionell agierender Risikokapitalfonds erreiche durchschnittlich nur das Elffache. *** Das exklusive Abo-Angebot für Sie als Handelsblatt Disrupt-Hörerinnen und Hörer: https://www.handelsblatt.com/mehrwirtschaft
